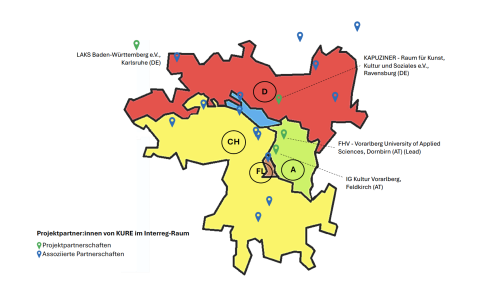Die Faust im Nacken. Kulturpolitik als strukturelle Gewalt
Eigentlich sollte es ja besser Kunstpolitik heißen, denn darum geht es ja schließlich in erster Linie: um die politische Aufbereitung des Kunstfeldes, um die Schaffung rechtlicher und finanzieller Strukturen für die Kunst. Aber Kunstpolitik hat einen leicht degoutanten Anklang, in dem der Totalitarismusverdacht mitschwingt - verbotene Kunst, Staatskunst, verbrannte Bücher und DissidentInnen können in dem Spannungsfeld von Kunst und Politik geortet werden.
Eigentlich sollte es ja besser Kunstpolitik heißen, denn darum geht es ja schließlich in erster Linie: um die politische Aufbereitung des Kunstfeldes, um die Schaffung rechtlicher und finanzieller Strukturen für die Kunst. Aber Kunstpolitik hat einen leicht degoutanten Anklang, in dem der Totalitarismusverdacht mitschwingt - verbotene Kunst, Staatskunst, verbrannte Bücher und DissidentInnen können in dem Spannungsfeld von Kunst und Politik geortet werden. Da ist Kulturpolitik schon ein schönerer Begriff, in dem der Glanz der Kultur quasi auf die Politik abfärbt - mensch hört Kulturpolitik und denkt an kultivierte Politik oder auch kultivierte PolitikerInnen. Bilder tauchen auf - der legendäre steirische Konservative Hans Koren im Lodenumhang als Förderer zeitgenössischer Literatur oder der Sozialdemokrat Rudolf Scholten im Nadelstreif, der seine Hand schützend über den Rebellen Claus Peymann hält.
Legenden selbstverständlich, Überhöhungen realer Machtbeziehungen, in denen - wie stets in der Geschichte - diejenigen nicht vorkommen, die aus welchen Gründen auch immer nicht die Gunst der kultivierten KulturpolitikerInnen fanden. Die österreichische Kulturpolitik in diesen Legenden ähnelt einem strengen Vater, der je nach Verfassung seine Kinder lobt, tadelt oder gar bestraft, ohne Gründe anzugeben oder gar Diskussionen zuzulassen. Die Struktur der Kulturpolitik und vor allem der zugehörigen Administration sind so gestaltet, dass Gleichberechtigung zwischen Kunstschaffenden und fördernden Körperschaften von vornherein ausgeschlossen ist: Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen getroffen, Ablehnungen und/ oder Kürzungen nicht transparent gemacht, Diskussionen über Entscheidungen befinden sich ohnehin außerhalb des Denkbaren.
Modernere Familienkonzeptionen sind in die österreichische Politik noch nicht vorgedrungen, da macht die Kulturpolitik keine Ausnahme. Es soll hier auch nicht der Eindruck entstehen, die kurzlebige "Wende"-Regierung sei an allem schuld. Das wäre zuviel der Ehre. Die eingangs beschriebenen Strukturen sind lange erprobt und haben sich bewährt, wenn es darum geht, Kunstschaffende in einer Art unmündigen Abhängigkeit festzuhalten.
Da hilft auch der löblicherweise in der Verfassung verankerte Begriff der "Freiheit der Kunst" wenig. Im Gegenteil, er ist selbst höchst problematisch, stellt doch schon die Bereitstellung finanzieller Mittel stets einen politischen Eingriff in das Kunstfeld dar. Dieses Dilemma sollte über die viel geschmähte Gießkanne abgeschwächt werden, die mit Hilfe der Expertisen von Beiräten, GutachterInnen, KuratorInnen etc. abgesichert werden wollte. Dummerweise ersetzt das alles weder kulturpolitische Zielsetzungen noch strukturelle Rahmenbedingungen.
Das Dilemma lässt sich indes auch auflösen - indem der Anspruch auf die Freiheit der Kunst einfach aufgegeben und die Macht ungebrochen ausgeübt wird. Einfach ehrlich, einfach eh schon wissen. Die gerade abgetretene österreichische Regierung schien sich zu dieser Variante entschlossen zu haben. Da gab es einen Bundeskanzler, der sich mit einem handverlesenen Kreis von ORF- und mediamilweit berühmten Schriftstellern und Philosophen schmückte, um wie weiland die großen Fürsten politische Macht mit der entsprechenden Symbolik zu kombinieren. Da gab es einen Staatssekretär, der auf jeglichen Anschein von Transparenz verzichtete, indem er sich jeder öffentlichen Diskussion seiner Tätigkeit und ihrer Folgen entzog. Da gab es politisch unliebsame Initiativen, die ausgehungert, in letzter Minute gerettet und wieder im Ungewissen gelassen wurden, bis sie entweder aufgaben oder sich an der kurzen Leine führen ließen. Da gab es schließlich eine Kulturministerin, die sich noch schnell vor der Wahl darum bemüht, die Kulturvermittlung auf ein Minimum zurückzustutzen - oder, wie es im O-Ton laut Standard vom 20. September 2002 heißt, "all diese wunderbaren Sachen (gemeint unter anderem das Österreichische Kulturservice, das Interkulturelle Zentrum, die Schulentwicklungszentren und das Büro für Kulturvermittlung) zu schlanken Strukturen zusammenzuführen". Dass diese Verschlankung zumindest im Fall des Österreichischen Kulturservice ziemlich sicher zum Verhungern führt und dass dieser Hungertod den langjährigen sozialdemokratischen Leiter des ÖKS, Michael Wimmer, schon die Stelle kostete, sind vermutlich nicht ganz unbeabsichtigte Nebenergebnisse dieser "effizienten Lösung".
Zusammengefasst: die blauschwarze Kulturpolitik war Repression plus nichts. Dieses Ergebnis entspricht exakt dem, was sich von Anfang an erwarten ließ. Diese Regierung ist angetreten, um uns das kleinste aller Defizite zu ermöglichen, nämlich das 0-Defizit. Sie ist angetreten, um die Steuern und die Staatsausgaben zu senken, um im Interesse der Wirtschaft zu handeln. Das ist ein bisschen abstrakt, da die Wirtschaft natürlich selbst keine Interessen hat. In jedem Fall wollte sie nicht den Fehler der Vergangenheit wiederholen und ideologisch handeln. Nur "Sachpolitik" wird gemacht und das ohne jede politische Richtung. Ideologie ist links und rationales Handeln das Credo der Regierung, das Gegenteil von links. Ideologie muss man sich eben leisten wollen.
Was können wir aus einem solchen Denken für die Kulturpolitik ableiten? Kulturpolitik ist zunächst einmal keine Wirtschaftspolitik. Das ist auch die Wurzel des Übels, dass Kulturpolitik stetig nach einer ökonomischen Rechtfertigung suchen muss. Sieht man von den Irrtümern und Missinterpretationen der Umwegrentabilität einmal ab, so gab es immer wieder Argumente, die Kulturpolitik als Standortpolitik missverstanden. Aber ganz generell ist Kulturpolitik genauso wie Umweltpolitik der in sonst allen Ministerien dominanten Wirtschaftspolitik ein Klotz am Bein.
Staatssekretär Morak wurde also mit einer sehr, sehr undankbaren Rolle abgespeist. Er musste Kulturpolitik machen zu einer Zeit, in der alle wussten, dass sie unnötig ist, und nur das wahre Ergebnis, der Output, durch "Quersubventionen" verfälscht wird. "Quersubvention" ist eines der markantesten Vokabel dieser Regierung. Wie sonst soll aber ein Bereich finanziert werden wenn nicht quer? Aus sich selbst heraus? Das Depot finanziert Public Netbase und das Volkstheater die Josefstadt? Morak also Staatssekretär für Querfinanzierung. Aussprüche wie "Kunst muss wehtun" oder "Kulturpolitik ist Ideologiepolitik" passen eben nicht mehr in diese moderne Zeit. Wenn heute was zählt, dann hat es sich bewährt und zwar auf dem Markt, und wenn es sich bewährt hat, kommt es mithilfe der Politik zu noch viel höheren Weihen, es wird sogar bewahrt. Wozu dann noch Kulturpolitik? Der Markt weiß ohnehin, wo es langgeht und jede Richtungsänderung wäre widernatürlich. Das einfachste Mittel, sich politisch/kulturpolitisch zu bewähren, war, die Budgets zu kürzen. Und genau das ist auch passiert. Es wurde gekürzt an allen Ecken und Enden. Es gab endlose Diskussionen, ob diese Art des politischen Rückzugs bösartig ist oder dumm oder beides. Das Rätsel wurde leider nie vollends gelöst.
Nach einiger Zeit dämmerte endlich die Entwederundoderlösung am Horizont der Marktwirtschaft. Die Creative Industries. Hier konnte sich der Staatssekretär endlich auch in der Sonne aalen. Und sich kurz vor dem unerwarteten frühen Ende der Legislaturperiode dann auch noch schnell kulturpolitische Inhalte leisten - oder was er darunter versteht. Und einen inhaltlichen Schwerpunkt aus dem Boden stampfen, der den nichtssagenden, um nicht zu sagen schwachsinnigen Titel "Kunst gegen Gewalt" trägt und mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet ist, um eine erhebliche Anzahl durchaus renommierter KünstlerInnen und KunstvermittlerInnen dazu zu bewegen, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen.
In der aktuellen Situation kann mensch nur hoffen, dass nach der Wahl alles oder zumindest manches anders wird - schließlich erscheint es ja nicht wirklich vermessen zu erwarten, dass der/die nächste PolitikerIn, der/die für Kulturpolitik verantwortlich zeichnet, etwas mehr Kenntnis und Engagement zeigt als der schwarzblaue Staatssekretär. Allerdings werden solche Hoffnungen durch eine Beobachtung der Kulturpolitik der Oppositionsparteien nicht gerade gestärkt. Zwar werden nun kurz vor den Wahlen wieder die üblichen Slogans geschwungen - ein Kultur-, Kunst- und Medienministerium soll es geben, dass sich wesentlich um das Zeitgenössische kümmert, das Budget soll gesteigert, die steuerlichen Anreize für Sponsoring sollen erhöht werden - doch warum die SPÖ nach dieser Wahl diese Dinge umsetzen sollte, für die sie ja vor 1999 reichlich Zeit gehabt hätte, bleibt im Dunkeln. Vielleicht weil die Grünen sie im Falle einer rot-grünen Koalition kulturpolitisch vor sich her treiben würden? Eine schöne Vision, gewiss, doch die außerordentlich schwammigen kulturpolitischen Zielsetzungen der Grünen, aufgrund derer sie "inhaltlich keine großen Differenzen mit der SPÖ" sehen (O-Ton Glawischnig im APA-Doppelinterview mit den Kultursprecherinnen der Grünen und der SPÖ, Glawischnig und Muttonen, 3. Oktober 2002), lassen auch hier wenig erwarten.
Fazit: Gepflegte Langeweile, wohin das Auge blickt. Auf der Seite der Schwarzen Konzepte, die vom Geist der 50er Jahre geprägt sind, von den Blauen dankenswerter Weise gar keine mehr. Und eine Opposition, die darauf setzt, vorhanden zu sein und es sich dabei mit so wenig potenziellen WählerInnen wie möglich zu verscherzen. Wer braucht da schon Kulturpolitik? Und auch wir können angesichts dieser Tristesse derzeit nicht wesentlich mehr Optimismus versprühen als eine Schallplatte von Vladimir Visotzky. In diesem Sinne wünschen wir mit Gurken und Vodka einen gemütlichen Winter.
Elisabeth Mayerhofer, Monika Mokre und Paul Stepan sind Mitglieder von FOKUS, Forschungsgesellschaft für kulturökonomische und kulturpolitische Studien.