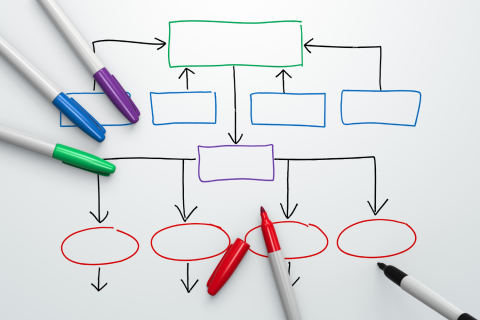Das kleine „Sowohl-als-auch“
<p>Kulturpolitik ist ein schwieriges Terrain und wie man’s macht, ist es falsch. Entweder es wird zu viel geredet und diskutiert und zuwenig getan oder es wird nur getan und nichts geredet und immer sind welche unzufrieden und schreien laut. Nichts für Menschen mit gesteigertem Liebesbedürfnis also. Zurzeit übrigens wird weder geredet noch getan – hat sich ja beides nicht bewährt – eine interessante Variante besonders vor dem Hintergrund, dass die Morak’sche
Kulturpolitik ist ein schwieriges Terrain und wie man’s macht, ist es falsch. Entweder es wird zu viel geredet und diskutiert und zuwenig getan oder es wird nur getan und nichts geredet und immer sind welche unzufrieden und schreien laut. Nichts für Menschen mit gesteigertem Liebesbedürfnis also. Zurzeit übrigens wird weder geredet noch getan – hat sich ja beides nicht bewährt – eine interessante Variante besonders vor dem Hintergrund, dass die Morak’sche Katastrophenpolitik an allen Ecken und Enden Reformbedarf hinterlassen hat: von der Künstlersozialversicherung über Verfahrensstandards der Fördervergabe bis hin zu einer Kulturverwaltungsreform. Von kulturpolitischen Schwerpunktsetzungen jenseits der Mozartkugel mal ganz abgesehen.
Interessant auch, dass dieses attraktive Feld politischer Profilierung weiter brach liegt und stattdessen das altbekannte Mikado wieder zum kulturpolitischen Leitbild mutiert ist. Also: Ja nichts ändern, sich hermetisch abriegeln und einfach alles, wie es übernommen wurde, verwalten. Und auch Letzteres unreformiert. Denn die zuständige Ministerin will nichts und niemanden gegeneinander ausspielen, wie sie in einem Interview betont, sondern mittels Kulturpolitik eine Balance zwischen dem kulturellen Erbe und der Gegenwartskunst herstellen (Der Standard, 26./27.01.2008).
Das ist nun gewiss ein hehrer Vorsatz und wäre im Grunde begrüßenswert, wenn sich auch nur die geringsten Anzeichen bemerkbar machen würden, dass es sich um ein ernst gemeintes Vorhaben handeln würde. Doch die Gesprächsbereitschaft mit VertreterInnen des Kunstbetriebs und seiner Institutionen beschränkt sich bisher auf die übliche Chefpartie, die sich schon seit längerer Zeit erfolgreich gegen jegliche Innovationsfreudigkeit immunisiert hat. Dringend notwendige Grundsatzgespräche verlieren sich so in persönlichen Eitelkeiten und Karrieregeilheiten.
Das ohnehin schon recht diffuse „Sowohl-als-auch“ wird durch die magere Bilanz für die Gegenwartskunst nicht gerade gestärkt: Neben einer Vielzahl von Ankündigungen ist die auf ganzer Linie enttäuschende Neufassung der Künstlersozialversicherung eine nicht gerade präsentable pièce de résistance des ersten Jahres sozialdemokratischer Kulturpolitik. Im Gegenteil. Das Ergebnis dieser Überarbeitung zeigt exemplarisch, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen von KünstlerInnen, außerhalb des Vereins der Wiener Philharmoniker, den politisch Verantwortlichen entweder völlig fremd oder gänzlich egal sind. Keines von beidem ist dabei wirklich wünschenswert. Um die – somit implizit eingestandenen – Informationsdefizite zu beheben, werden nun Auftragsstudien verfasst, auf deren Ergebnisse mit Spannung gewartet wird. Vielleicht tun sich hier ja noch Überraschungen auf.
Aber auch was die finanzielle Seite der Kulturpolitik angeht, lässt sich der Trend zur Passivität feststellen. Selbstverständlich hat dabei weiland Franz Morak den Vogel abgeschossen, indem er sich Jahr für Jahr unter eifrigen Dankesbezeugungen ein geringeres Budget zuweisen hat lassen. Aber auch davor und danach stagnierten die Budgets mehr oder weniger und die operativen Budgets gehen soundso gegen null, denn die Gelder sind auf Jahre hinaus bereits verplant. Kleinere und größere Institutionen müssen erhalten werden und die Kosten für die Erhaltung steigen wesentlich schneller als die dazugehörigen Budgets. Dieser Umstand wird uns in wenigen Jahren zu dem wunderbaren Zustand des totalen Stillstandes bringen, wenn mit dem Kunstbudget alles erhalten, aber genau nichts mehr produziert werden kann.