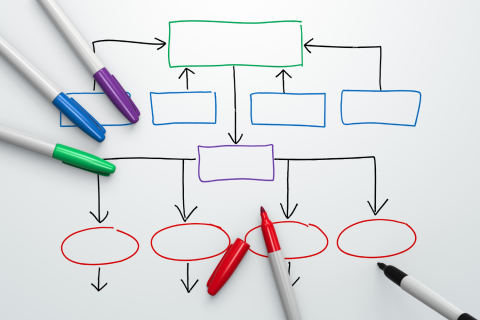Das Fairnessdilemma der Kulturpolitik
„Die natürliche Verteilung ist weder gerecht noch ungerecht… Es handelt sich einfach um natürliche Tatsachen. Gerecht und ungerecht ist der Umgang der Institutionen mit diesen Tatsachen.“ Als Reaktion auf die Covid-Krise hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer im Herbst 2020 den „Fairness-Prozess“ gestartet. In dem beim Fairness-Symposium im September 2021 publizierten Zwischenbericht ist folgende Zielvorgabe nachzulesen: „Fairness in Kunst und Kultur in Österreich zu verbreiten.“ Es ist ein vage formuliertes Ziel, das wohl absichtsvoll offenlässt, ob mit „Verbreitung“ die tatsächliche Implementierung von Maßnahmen oder lediglich eine Diskursoffensive gemeint ist.
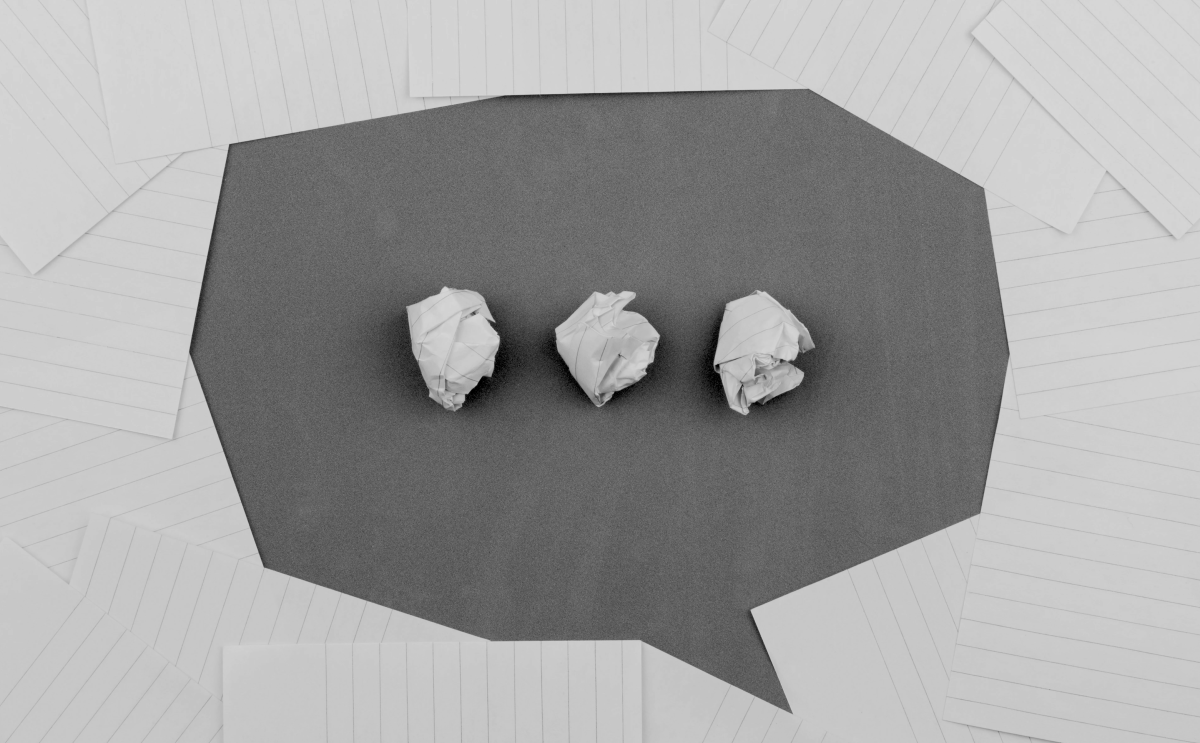
Obwohl es um Fairness zwischen unterschiedlichen Gruppen geht, erfolgt die Einbindung der Zivilgesellschaft, bzw. der Interessenvertretungen im Kulturbereich nur sehr rudimentär. Sie wird aber gerne als tatsächliche Beteiligung nach Außen dargestellt.
Wenn man den Begriff Fairness mit Gerechtigkeit gleichsetzt, sollte man sich im Laufe dieses Prozesses ständig bewusst sein, dass das Erreichen von „Gerechtigkeit“ immer mit einem Dilemma verbunden ist: Jene, die über Ressourcen verfügen und darüber entscheiden, haben von größerer Gerechtigkeit keinen Vorteil, und jene, die betroffen sind, haben wiederum keinen Einfluss auf die Entscheidungen.
Dialog in Schieflage
Die Rolle der Interessenvertretungen im „Fairness-Prozess“ ist in diesem Dilemma gefangen. Das BMKOES räumt den Interessenvertretungen keinen Einfluss auf die Prozessarchitektur, die Zieldefinition und den Zeitrahmen ein. Sie können nicht mitentscheiden, welche Themen Aufnahme in den Prozess finden. Dennoch wird von Seiten des Staatssekretariats gerne das Bild einer Beteiligung gezeichnet und selbst Ergebnisse, zu denen einzelne IGs starke Vorbehalte aussprechen, werden als „im Dialog mit den Interessenvertretungen“ entstandenes Resultat präsentiert.
Dies war bei der Konzeption des Fairness-Symposiums der Fall. Hier durften die IGs weder an der Gestaltung mitwirken, noch wurde ihren Vertreter_innen ein Programmpunkt zugestanden. Nur in der Rolle des Publikums war es möglich, das Fair-Pay-Manifest der IG Kultur Österreich und den Fair Pay Reader des Kulturrates zu verteilen. Diese ungleiche Rollenverteilung wiederholt sich soeben bei der Erstellung des „Fairness-Kodex“. Dieser wurde teilweise aus dem Fair Practice Code der Niederlande übernommenen und vom BMKOES ausformuliert. Er richtet sich inhaltlich vorrangig an die Kulturschaffenden. Ihnen wird empfohlen, sich in ihrer Arbeit für mehr Vielfalt und Nachhaltigkeit einzusetzen und im Umgang miteinander professioneller und transparenter vorzugehen. Alle Änderungen an diesem Text, welche z.B die IG Kultur Österreich einforderte, wurden nicht berücksichtigt. Insofern ist es korrekt, dass Interessenvertretungen in die Texterstellung eingebunden waren und ihre Beiträge leisteten. Wenn diese Beiträge aber weder verhandelt, noch von der mächtigeren Seite aufgenommen werden, ist die Aussage, dass dies mit den Interessenvertretungen gemeinsam erarbeitet wurde, bewusst irreführend.
Die IG Kultur Österreich investiert ihre begrenzten Ressourcen vor allem in die Fair-Pay-Kampagne. Hier konnten auch schon Erfolge erzielt werden, von einer nachhaltigen Umsetzung ist man noch immer weit entfernt. Denn um tatsächlich zu fairen Bezahlungen zu kommen, braucht es eine strukturelle Neuausrichtung der Förderpolitik.
Fair Pay in der Förderpraxis, wie weiter?
Ein Erfolg ist die für 2022 vom Bund zur Verfügung gestellte Summe von 6,5 Mio € für Fair Pay. Damit wird der Bundesanteil der Subventionen an den Gesamteinnahmen prozentuell angehoben um den Fair-Pay-Gap ein Stück zu schließen. Die Summe von 6,5 Mio € beruht auf einer Schätzung der Kunstsektion. Es wurde zwar vom Gallup Institut eine Fair-Pay-Gap Studie 2021 durchgeführt, allerdings beteiligten sich daran nur rund 200 Institutionen, sodass der erhobene Bedarf nicht repräsentativ war. Auch konnte mit dieser Studie nicht die faire Bezahlung von Künstler_innen außerhalb von Institutionen erfasst werden. Sie wurden nur dann eingerechnet, wenn Galerien oder Veranstalter_innen die Honorare für ausstellende oder auftretende Künstler_innen angegeben haben – was grundsätzlich so im Studiendesign vorgesehen war. Über die genaue Vorgangsweise bei der Verteilung der Mittel schweigt sich das Staatssekretariat noch aus. Stattdessen wurde auf die für März 2022 anberaumten Gesprächsrunden mit Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften verwiesen. Die fördertechnischen Fragen zu Fair Pay, die Verteilung und damit die Umstellung auf eine faire Förderpraxis hätten sinnvollerweise vor der Verteilung der Mittel ausgearbeitet werden sollen. Die Expertise der Interessenvertretungen in Nachhinein einzuholen, führt uns zu dem vom amerikanischen Philosophen John Rawls definierten Dilemma zurück. Bis diese Gespräche tagen und Lösungen ausgearbeitet wurden, haben die Entscheidungsträger_innen das Geld schon nach eigenen Präferenzen ausgegeben.
Eine tatsächliche Schließung des Fair-Pay-Gaps lässt sich nur durch die Beteiligung der Länder und anderer öffentlicher Fördergeber_innen erreichen. Positiv hervorheben lässt sich, dass der Bund hier eine Koordinierungsfunktion übernommen hat und die Gebietskörperschaften regelmäßig zum Austausch einlädt. Die Vorreiterrolle, welche Land Salzburg übernommen hat, als erstes Bundesland eine Fair Pay Strategie umzusetzen, wird hoffentlich weitere Bundesländer und Städte motivieren mitzumachen.
Fairpay als Förderkriterium? Pilotphase im Blindflug
Inzwischen führen die vagen Aussagen des Staatssekretariats zu Verunsicherung der Kulturszene. Folgender ebenfalls im Zwischenbericht zum Fairness-Prozess erschienene Absatz sorgt zurzeit für große Verunsicherung: „Als ersten Schritt hat der Bund bereits Fair Pay als berücksichtigungswürdiges Kriterium in alle neuen Ausschreibungen integriert. Die Beiräte und Jurys werden auf die Anwendung der Honoraruntergrenzen der Interessengemeinschaften in Förderansuchen sensibilisiert und sind dazu angehalten, Fair Pay in ihrer Bewertung von Förderansuchen zu berücksichtigen.“ Diese – nicht mit den Interessenvertretungen abgesprochene Maßnahme – kann durchaus so ausgelegt werden, dass Kultureinrichtungen nur mehr dann eine Förderung erhalten, wenn sie trotz Unterfinanzierung faire Gehälter und Honorare bezahlen.
Es kostet einige Anstrengung um folgende, mit dem Staatssekretariat abgestimmte Klarstellung unter die Antragsteller_innen zu bringen: Als Beurteilungskriterium wird die grundsätzliche Bereitschaft zur Bezahlung von fairen Honoraren und Gehältern, die in den Kalkulationen ausgewiesen werden müssen, bewertet. Es geht nicht darum, dass nur jene, die tatsächlich fair bezahlen, eine positive Beurteilung bekommen. Es werden auch jene positiv beurteilt, die eine faire Bezahlung anstreben/kalkulieren. Wenn Antragsteller_innen aber zu wenig Förderung bekommen, müssen sie weiter entsprechend unfaire Honorare auszahlen, ohne dass dies negative Folgen in der Abrechnung oder nächsten Bewertung haben wird. Eine für Fair Pay gewidmete Förderung muss aber immer in Honorare oder Gehälter fließen. Wenn für Organisationsarbeiten keine Mittel benötigt werden, weil die involvierten Personen ehrenamtlich arbeiten wollen, dann sollte im Antrag darauf explizit hingewiesen werden. Dies führt zu keinem Nachteil in der Beurteilung, muss aber für die Beiräte nachvollziehbar sein.
Solange die Interessenvertretungen nicht als Partner_innen in diesem Fairness-Prozess gleichberechtigt agieren können, wird Fairness nicht verhandelbar sein und es bleibt das, was es ist: Politshow.

Gabriele Gerbasits ist Teil des Führungsteams der IG Kultur Österreich und war Beamtin im Kulturministerium.
Fußnoten
1 John Rawls, A Theory of Justice (1971; 1975; 1999), Chapter II, Section 14, pg. 87–88
2 www.kulturrat.at/fair-pay-reader
3 www.fairpracticecode.nl
4 www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Fairness.html
Ursprünglich erschienen in der Ausgabe Nr. 60 /Melancholia von links /der Zeitschrift /Bildpunkt/ der IG Bildende Kunst.