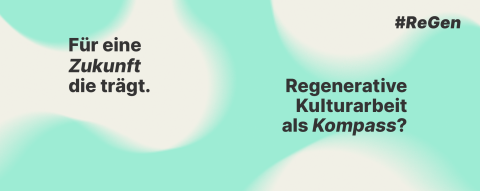Jeff Bernard, organischer Intellektueller (1943-2010)
Der kulturpolitische Aktivist hatte sich – in Habitus und diskursivem Gelehrtenduktus – als besonders akribischer sozialwissenschaftlicher Forscher getarnt, der auch die von ihm beforschten Szenen mit seinem monumentalen Werk etwas überforderte: vier Bände über die „Strukturen autonomer Kulturarbeit in Österreich“, alle an die 700 Seiten dick!
An einem klaren frühwinterlichen Morgen fuhr ich im Dezember 1994 mit Jeff Bernard zu einem gemeinsamen Kongress der IG Kultur Österreich und der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren nach Nürnberg. Eine lange, aber für mich äußerst kurzweilige Autofahrt, weil sie mir einen intensiven Einblick in die Welt lieferte, die in den kommenden Jahren auch meine Welt sein würde. Jeff war jedenfalls wahrscheinlich gerade an einem späten Höhepunkt seines Interesses für das Feld der autonomen Kulturarbeit, wie er selbst es begrifflich gefasst hatte: jener Szenen also, die mit der Arena-Bewegung in den 1970ern ihren sehr materiellen und lautstarken Ursprungsmythos erfunden hatten, die in den 1980ern bis in die letzten Täler wucherten und in den 1990ern einen von zwei möglichen Wegen einschlugen – mehr oder weniger bewusst: Managementisierung, „Marketisierung“, Depolitisierung als „Kulturdienstleister“ oder politische Vernetzung, Organisierung, Aktualisierung der alten Forderung nach antisexistischer, antirassistischer und antifaschistischer Kulturarbeit.
Jeff war ganz klar auf der Seite des zweiten Pols. Das war allerdings nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Der kulturpolitische Aktivist hatte sich – in Habitus und diskursivem Gelehrtenduktus – als besonders akribischer sozialwissenschaftlicher Forscher getarnt, der auch die von ihm beforschten Szenen mit seinem monumentalen Werk etwas überforderte: vier Bände über die „Strukturen autonomer Kulturarbeit in Österreich“ (Band1/2: 1990, Band 3/4: 1995), alle an die 700 Seiten dick!
Auf der langen Fahrt von Wien nach Nürnberg erzählte mir Jeff viele Details seiner Interviews mit den über ganz Österreich verstreuten AkteurInnen der Kulturarbeit, Kulturverwaltung und Kulturpolitik, vermischt mit (auto-)biografischen Bruchstücken und mikropolitischen Skurrilitäten. Und ähnlich taten und tun sich jenen wahrscheinlich viel zu wenigen, die sich in das Bernardsche Werk vertiefen, Welten auf: die Heterokosmen jener Zeit, als alternative Kultur ein Abenteuer der Wunschproduktion war, nicht mehr so radikal vielleicht, wie in den hippieesken und punkingen Jahrzehnten davor, aber dafür eine unendliche molekulare Vielfalt. Und die sonst oft als oberflächlich oder depressiv verschrienen 1980er Jahre bekommen aus dieser Perspektive ein neues Gesicht.
Jeff Bernards Arbeit ging aber weit über die Dokumentation und Analyse einer vergangenen Ära hinaus: Durch sehr intelligent geführte, offene Interviews entstanden gemeinsame Erkenntniseffekte, durch den semiotischen Hintergrund ein kohärenter Theorierahmen und schließlich durch das politische Interesse des Autors ein seltener Grad der Konkretion, auch was politische Schlussfolgerungen betrifft. Er nannte seine Studien eine „aktivierende Begleituntersuchung“ und wurde in einem sehr prägnanten Sinn damit zu einem Exempel des Gramsci’schen „organischen Intellektuellen“.
Aus der akribischen Analyse des sozialen Felds ergab sich die Notwendigkeit, ein ebenso akribisches strategisches Szenario und als Draufgabe einen Handlungsplan zu entwickeln. Obwohl diese vor allem in Band 3 ausgearbeiteten Strategien nicht gerade von vielen gelesen wurden, ein paar von uns damals in die IG Kultur Involvierten lasen sie sehr genau. Wenn Jeff Bernard konstatierte, es wäre an der Zeit, dass sich die verschiedenen Interessenvertretungen im kulturellen Feld stärker vernetzten und politisch gemeinsam agierten, dann war das mit Grund dafür, dass wir uns gemeinsam mit anderen für die Gründung dessen stark machten, was zuerst „Kulturpolitische Kommission“ hieß und heute „Kulturrat Österreich“ heißt. Wenn Jeff Bernards Analyse die Erweiterung der IG Kultur-Sphäre nahelegte, dann machten wir uns auf, mit den Freien Radios, den Netzkultur-Initiativen, den künstlerischen Kollektiven zu kooperieren, später auch Brücken zum politischen Aktivismus, vor allem zum politischen Antirassismus und zu feministischen Initiativen zu schlagen. Jeffs keineswegs als kulturalistisch oder essentialistisch zu verstehende Idee der „Kulturpartei“ blieb zwar virtuell, aber die IG Kultur Österreich war bald kein Mitgliederverband mehr, der brav dem kleinsten gemeinsamen Nenner seiner Glieder entsprach, sondern ein transversales Gefüge, das immer wieder diskursive und aktivistische Fluchtlinien produzierte. Zunächst aber und zuallererst machten wir 1996 etwas, das Jeff Bernard auch in den Jahren davor immer wieder eingefordert hatte: Wir gründeten eine Zeitschrift, und die hieß dann – in Ermangelung fantasievollerer Namen – Kulturrisse.
Jeff Bernard, einziges Ehrenmitglied der IG Kultur Österreich, starb am 24. Februar 2010 an den Folgen eines schweren Herzinfarkts.
Gerald Raunig ist Philosoph und war von 1994 bis 2002 Mitglied des Vorstands der IG Kultur Österreich.