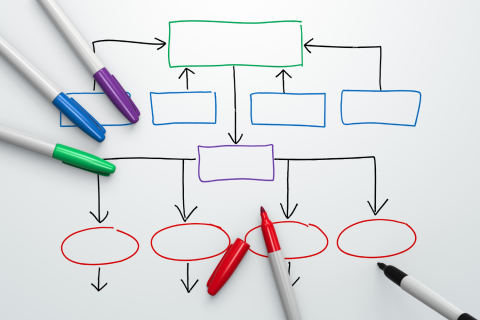Wiener Kulturpolitik. Dasselbe in Grün.
Wir waren naiv. Wir geben’s zu, auch wenn jetzt einige abgeklärte Leser_innen den Kopf schütteln werden: Ja, wir haben uns gefreut, als vor einem Jahr die rot-grüne Koalition in Wien angetreten ist. Wir hofften auf Öffnungen und – ja – auf Änderungen. So. Fast ein Jahr später ist die Entzauberung da.
Wir waren naiv. Wir geben’s zu, auch wenn jetzt einige abgeklärte Leser_innen den Kopf schütteln werden: Ja, wir haben uns gefreut, als vor einem Jahr die rot-grüne Koalition in Wien angetreten ist. Wir hofften auf Öffnungen und – ja – auf Änderungen. So. Fast ein Jahr später ist die Entzauberung da.
Es beginnt zunächst erfreulich: Ein neuer Impuls wird gesetzt, ein neues Festival, Wienwoche, wird ab 2012 an verschiedenen Konflikt beladenen Orten im Stadtgebiet genreübergreifend Interventionen setzen. Soweit, so begrüßenswert und notwendig, gibt es doch noch immer zu wenige solcher Initiativen, vor allem außerhalb der Kernbezirke, die kontextspezifisch arbeiten.
Doch dann das schlimme Erwachen: Auf der Website findet sich folgender Eintrag: „Die Idee für das neue Kulturprojekt erfolgt auf Initiative der Grünen Wien, die ‚Wienwoche‘ von Anfang an unterstützen“ (wienwoche.org; 13.09.2011). Die Wiener Grünen initiieren Kulturprojekte, die dann aus dem Kulturbudget der Stadt gefördert werden. Hier ist es nun an der Zeit, demokratiepolitische Gedächtnislücken wieder zu schließen: Öffentliche Kulturförderung richtet sich an Künstler_innen und Kulturarbeiter_innen, um diese Projekte zu ermöglichen. Selbstermächtigt und selbstbeauftragt. Denn Ideen gibt es genug, darüber müssen sich Politiker_innen nicht den Kopf zerbrechen. Wenn Parteien Kulturprojekte durchführen wollen – und daran soll sie niemand hindern –, dann eben mit eigenen oder privaten Mitteln, nicht mit öffentlichen. Aber vielleicht haben die Grünen hier nur etwas missverstanden: Wenn die Politik Rahmenbedingungen für künstlerische Arbeit schaffen soll, dann ist damit nicht gemeint, dass sie Festivals erfindet, Häuser baut und Sammlungen anlegt, sondern dass sie strukturell agiert. Beispielsweise für Transparenz sorgt, für nachvollziehbare Abläufe, für Infrastrukturen, vor allem aber für eine angemessene Entlohnung der Akteur_innen.
Und hier spleißt es sich schon wieder: Natürlich ist es wunderbar, wenn eine neue Initiative gleich so gut dotiert ist, dass sie 100.000 EUR nur für Vorbereitung und den Aufbau einer Infrastruktur verwenden kann. Nur: Warum wird dann anderen Wiener Kulturinitiativen, die seit Jahren am Existenzminimum arbeiten, jede Erhöhung der Förderung mit dem Hinweis auf knappe Budgets versagt? Was sollen sich die Kulturarbeiter_innen denken, denen jetzt schon Kürzungen für 2012 in Aussicht gestellt werden? Werden sie genauso tatkräftig von den Wiener Grünen unterstützt werden, indem das Budget erhöht wird, und alle profitieren, anstatt eine Spaltung der Szene zu erreichen?
Natürlich ist die Praxis nicht neu, ein Luxusprojekt allen anderen vor die Nase zu setzen, die sich jahrelang abmühen. Ebenso wenig wie die Vorliebe von Politiker_innen für Selbstrepräsentation im Kultursektor. Was dem Einen die Premierenfeier der Hochkultur, das ist dem Anderen das alternative Kulturfestival.
Was hier fehlt, sind grundlegende Überlegungen zu demokratischer Kulturpolitik in einer repräsentativen Demokratie. Nicht ganz einfach, geht es doch nicht darum, Politik ohne gesellschaftspolitische Visionen zu betreiben; aber eben auch nicht darum, Kultur für Parteipolitik in die Pflicht zu nehmen; sondern darum, Kunst- und Kulturinitiativen zu fördern, die sich ohne parteipolitischen Anstoß entwickelt haben und bei der Auswahl der Fördernehmer_innen so gerecht und transparent wie möglich vorzugehen.
Aber so schwierig ist es dann auch wieder nicht. Man könnte z. B. im Grünen Kulturprogramm 2008 nachschauen, in dem es heißt: „Kein Geld aus der Kultur für (…) politische Selbstdarstellung.“ Das sollte nicht nur für die Salzburger Festspiele gelten.