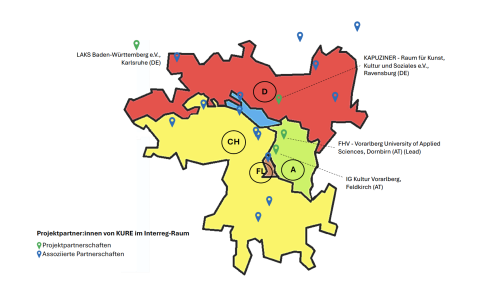Nach dem Nordatlantik. Für eine Euro-Mittelmeer-Union
Die Vorstellung, dass Regionen eine Identität haben oder dass ein Territorium über eine wohldefinierte kulturelle Identität verfügen muss, um als Region betrachtet zu werden, ist ein sowohl auf innerstaatlicher als auch auf supranationaler regionaler Ebene bei vielen PolitikerInnen und öffentlichen VertreterInnen weit verbreitetes, starres Denkmuster.
In Diskussionen über die Europa-Mittelmeer-Region taucht früher oder später die Frage auf, ob man sie überhaupt als Region bezeichnen kann. Diese Skepsis geht von einem bestimmten Regionenkonzept aus. Denn was für viele fehlt, um den Mittelmeerraum als Region zu betrachten, ist eine Form der kulturellen Identität. Unterscheidet sich der nördliche Mittelmeerraum nicht sehr vom südlichen Mittelmeerraum? Und ist nicht auch der östliche Mittelmeerraum sehr spezifisch? Der eine Typ von Euromed-SkeptikerInnen sagt also, aufgrund fehlender Identität gebe es keine Mittelmeerregion. Ein anderer Typ geht sogar noch weiter und sagt mit Samuel Huntingtons These vom "Kampf der Kulturen", dass der mediterrane Raum ein Schlachtfeld ist, jenes Gebiet, wo der Westen, der Islam und die Orthodoxie gewaltsam aufeinander getroffen sind, was früher oder später auch wieder passieren würde.
Die Vorstellung, dass Regionen eine Identität haben oder dass ein Territorium über eine wohldefinierte kulturelle Identität verfügen muss, um als Region betrachtet zu werden, ist ein sowohl auf innerstaatlicher als auch auf supranationaler regionaler Ebene bei vielen PolitikerInnen und öffentlichen VertreterInnen weit verbreitetes, starres Denkmuster. Hier gilt es, auf die Ambiguität des politischen Konzepts der Region zu verweisen. Auf der einen Seite gibt es die RegionalistInnen, die sofort an eine kulturelle Identität ihrer Region glauben und eine solche für sie herstellen, was in einigen Fällen mit einer kompetitiven, antagonistischen oder offen auf Konflikt ausgerichteten Zielsetzung gegenüber der politischen Ebene des Nationalstaats, dem die Region angehört, verbunden ist. Diese RegionalistInnen sind meist äußerst aktiv innerhalb der Diskussion um ein "Europa der Regionen" und unterstützen oft nicht zufällig in einigen dieser Regionen Autonomiebestrebungen oder separatistische Tendenzen. Auf der anderen Seite gibt es jene RegionalistInnen, die Europa selbst als Region sehen. Im Gegensatz zum politischen Horizont der innerstaatlichen RegionalistInnen ist jener der SupraregionalistInnen weder ein einzelner Staat noch die EU selbst, sondern die Welt. Auch hier lässt sich wieder zwischen zwei Typen europäischer SupraregionalistInnen unter PolitikerInnen, öffentlichen VertreterInnen und MeinungsbilderInnen, die Europa als Region definieren, unterscheiden. Für den einen Typ stellt Europa wegen seiner spezifischen kulturellen Identität im Verhältnis zu anderen Weltregionen eine Region dar. Für sie existiert eine die Vielfalt ihrer konstitutiven Teile umfassende kulturelle Einheit. Diese RegionalistInnen sind besonders mit Diskussionen wie jenen über die Grenzen der EU befasst, und sie messen die Eignung eines Landes für eine EU-Mitgliedschaft hauptsächlich an kulturellen Argumenten. Für sie stellen die Ambitionen der Türkei, EU-Mitglied zu werden, wahrscheinlich ein Problem dar. Sie verweisen auf den christlichen Charakter der EU und behaupten, dass ein Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung nicht in die europäische Identität hineinpasse.
Das Beispiel der Türkei hilft dabei, den Unterschied zwischen identitären europäischen SupraregionalistInnen und jenen, die wir positionelle oder geopolitische europäische SupraregionalistInnen nennen könnten, zu bestimmen. Diese wollen Europas Position hauptsächlich auf der Ebene der Weltpolitik definieren. Somit haben wir beispielsweise einen europäischen Regionaldiskurs, der fordert, dass Europa über eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik verfügen sollte. Dieser Diskurs tritt für einen Sicherheitsrat ein, der nicht, wie es heute der Fall ist, aus fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern besteht, sondern aus VertreterInnen der Regionen, von denen eine die EU wäre. Für diesen Typ europäischer RegionalistInnen stellt die EU auch ein Modell der politischen Integration für andere Regionen dar, in dem "Regionen" beinahe synonym gesetzt werden mit "Kontinenten" Und aus dieser geopolitischen, im Kontrast zu einer identitären Perspektive stehenden Sicht würden diese SupraregionalistInnen wohl für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei eintreten.
Nun wollen wir sehen, welche verschiedenen Gruppen bis jetzt die politische Auseinandersetzung in meinem imaginären Club Euroméditerranée beleben: Wir haben die differentialistischen Euromed-SkeptikerInnen, die Euromed-Schlachtfeld-SkeptikerInnen, die identitären, autonomistischen oder separatistischen europäischen innerstaatlichen RegionalistInnen, die identitären europäischen SupraregionalistInnen und die geopolitischen europäischen SupraregionalistInnen. Aber wo es SkeptikerInnen gibt, gibt es auch believers, jene PolitikerInnen, öffentliche VertreterInnen und MeinungsbilderInnen, die an diese bestimmte Region glauben. Die Euromed-VerfechterInnen liegen jedoch nicht notwendigerweise im Streit mit den Euromed-SkeptikerInnen. Es ist durchaus möglich, zwar nicht an eine Identität des Mittelmeerraums, trotzdem aber an die Region zu glauben. Um an den Mittelmeerraum zu glauben, müssen wir nicht davon überzeugt sein, dass er über eine Identität verfügt. So gesehen ist es möglich, gleichzeitig Euromed-VerfechterIn und differentialistische Euromed-SkeptikerIn zu sein. Hingegen ist es unmöglich, sowohl Euromed-VerfechterIn als auch Euromed-Schlachtfeld-SkeptikerIn zu sein. Der Glaube an den Europa-Mittelmeerraum muss als geopolitische Philosophie betrachtet werden, die in einem klaren Widerspruch zur Weltsicht eines Samuel Huntington steht.
Tatsächlich ist der offizielle, von einer Europa-Mittelmeer-Region ausgehende Euromed-Regionaldiskurs natürlich ein regionaler Diskurs auf supranationaler und nicht auf nationaler Ebene. Der "Barcelona-Prozess", initiiert durch die Deklaration der Außenministerkonferenz der EU und der Mittelmeerländer in Barcelona am 27./28. November 1995, beschreibt den Prozess der Entwicklung "freundschaftlicher Beziehungen" zwischen den Ländern der Europa-Mittelmeer-Region. Auf drei Partnerschaftsebenen sollten diese freundschaftlichen Beziehungen formuliert werden: Erstens einer politischen und Sicherheitspartnerschaft durch die Schaffung eines Gebiets von Frieden und Stabilität; zweitens einer wirtschaftlichen Partnerschaft durch die Schaffung eines Raums gemeinsamer Prosperität; und drittens einer Partnerschaft in sozialen, kulturellen und personellen Angelegenheiten durch die Entwicklung von Personalressourcen und die Förderung von kulturellem und zivilgesellschaftlichem Austausch. Zur Zeit der Deklaration von Barcelona hatte die EU noch fünfzehn Mitgliedstaaten – jetzt sind es fünfundzwanzig – und auf der "Mittelmeer"-Seite waren zwölf "Länder" involviert (Marokko, Algerien, Tunesien; Ägypten, Jordanien, Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde, Libanon, Syrien; Türkei, Zypern und Malta), wovon zwei (Zypern and Malta) in der Zwischenzeit Mitgliedstaaten der EU geworden sind.
Es ist die eigene Entscheidung eines Landes, einen Teil seiner Souveränität aufzugeben und EU-Mitgliedstaat zu werden, doch Artikel 1,1.2 des vom europäischen Konvent vorgeschlagenen Verfassungsvertrags beschränkt diese Möglichkeit auf "europäische Länder". Und selbst wenn von einigen angezweifelt wird, dass die Türkei ein europäisches Land sei, so stellen ganz klar weder die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft (MEDA) noch der Barcelona-Prozess für alle anderen Mittelmeer-Partner einen Fahrplan zu einer EU-Vollmitgliedschaft dar. Euromed-SkeptikerInnen könnten folglich argumentieren, die ganze Rede von Euromed sei nichts anderes als eine freundliche Form des Ausschlusses der Anderen. Abgesehen von der Türkei stellt für keines der anderen Mittelmeerpartner eine EU-Mitgliedschaft eine Option dar und die den Euromed-Diskurs prägende Freundschaftsrhetorik lässt sich lesen als subtile Strategie, den bleibenden Ausschluss zu sichern. Außerdem könnten Euromed-ZynikerInnen ins Treffen führen, dass die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft eigentlich nur als Kooperationsform für eine effizientere Abschottung gegen jene Menschen aus den Mittelmeerländern dient, die in die EU kommen wollen.
Man sollte tatsächlich nicht naiv sein, was die Vereinnahmungsmöglichkeiten der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft und einiger ihrer Programme seitens der VerteidigerInnen einer "Festung Europa" anbelangt. Doch muss dies nicht unbedingt ihr politisches Schicksal sein. Deshalb sollte sich die öffentliche Meinung in Europa der Existenz des formalen Rahmens der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft ebenso wie seiner Potenziale bewusst werden, um die "Festung Europa" aufzubrechen. Die "Festung Europa" ist mittlerweile zu einem überaus gängigen Schlagwort geworden, aber die Kritik an den Politiken der EU sollte sich sorgfältig mit europäischen Prozessen, Projekten und Programmen auseinandersetzen, die eine gewisse Ambivalenz in sich bergen und sich in die eine wie in die andere Richtung entwickeln könnten. Wahrscheinlich stellt die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft eines der vielversprechendsten Instrumente gegen die "Festung Europa" dar, selbst wenn ihre GestalterInnen sie als rhetorisches Mittel zu deren Verteidigung gedacht haben mögen. Eine Analyse des Euromed-Diskurses sollte einige seiner eklatantesten Widersprüchlichkeiten zum Vorschein bringen. Er basiert zu einem hohen Grad auf einer Politik des freien Marktes, während es gleichzeitig immer schwieriger wird, für Menschen aus den nicht zur EU gehörenden Mittelmeerländern in die Union zu kommen. Dem Humankapital scheint nicht die gleiche Freiheit zugestanden zu werden wie dem Finanzkapital. Deshalb sollten wir im Namen der Freundschaft fordern, dass die EU für die BürgerInnen der Mittelmeer-Partnerstaaten ebenso zugänglich ist. Weiters sollte die EU den Rahmen der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft weitaus erkennbarer in der Frage Palästinas einsetzen. Die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft sollte ebenso bekannt sein wie die NATO.
Es gab einmal eine Zeit, als der Nordatlantik als Region betrachtet wurde, und zwar aus offensichtlichen ideologischen Gründen. Das war "der Westen", die "freie Welt". Heute ist es viel wichtiger, Allianzen über die Teilung in Ost und West und Süd und Nord hinweg zu etablieren. Seit dem März 2003 führen die USA trotz der weltweiten und in der Geschichte größten Proteste einen unilateralen Krieg im Irak, und die Allianz wartet nur auf ihre Auflösung. Die heutige Generation führender EuropapolitikerInnen versucht, die guten Beziehungen zu den USA wiederherzustellen, selbst nach der Wiederwahl von George W. Bush, einem für viele höchst kontroversiellen Präsidenten. Doch zukünftige Generationen von führenden PolitikerInnen in Europa sind so frustriert vom Unilateralismus der USA im Irak, weshalb ich glaube, dass sie der Region des kalten Kriegs, also dem Nordatlantik, den Rücken zukehren und sich dem Mittelmeerraum zuwenden werden. Diese Entwicklung wird auch dadurch unterstützt werden, dass ein wachsender Prozentsatz von Europas jüngerer Bevölkerung aus dem Mittelmeerraum stammen wird.
Die Euro-Mittelmeer-Union: sollte nicht sie unser großes politisches Projekt darstellen? Die Außenpolitik der USA sieht die EU nicht länger als Verbündete, sondern als eine ihrer größten Konkurrentinnen im Kampf um Hegemonie. Die EU sollte keine Angst haben davor, hegemonial zu werden. Es ist höchste Zeit, dass sich die höheren EU-VertreterInnen und PolitikerInnen dieser geopolitischen Realität stellen, statt jede Kritik an der Außenpolitik der USA als primitiven Antiamerikanismus abzustempeln. An den Mittelmeerraum zu glauben, setzt natürlich voraus, dass die Mittelmeerpartnerländer bereit sind, mehr in Richtung der EU als in die der USA als Vermittlerin von Frieden und demokratischem und humanitärem Wandel zu blicken. Wenn der mediterrane Raum und die arabische Welt es wollten und die EU bereit wäre, dies zu akzeptieren, könnte die EU schon von morgen an eine führende Rolle auf der Ebene der Weltpolitik einnehmen. Es braucht zwei, um eine neue Hegemonie herzustellen, und die Allianz zwischen dem Mittelmeerraum und Europa könnte der Schlüssel sein zu dieser neuen Hegemonie, die "Kulturen" nicht als grundsätzlich konfliktuell, sondern als Chancen für einen Dialog betrachtet. Die Euro-Mittelmeer-Union könnte die politische Institution dieses Dialogs sein.
Dieter Lesage ist Philosoph und arbeitet am Department for Audiovisual and Performing Arts RITS (Erasmushogeschool Brüssel) und am Piet Zwart Institute der Willem De Kooning Akademie in Rotterdam.
Übersetzung aus dem Englischen: Therese Kaufmann