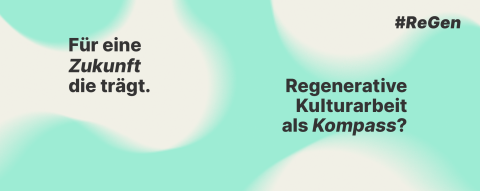FAIR PAY für freie Kulturarbeit braucht Faktenbasis
Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek erklärt FAIR PAY für in Kunst und Kultur Tätige zur Priorität. Die Interessenvertretungen der freien und autonomen Kulturarbeit begrüßen diese Zielsetzung und fordern als ersten Schritt eine österreichweite Erhebung, die eine solide Faktenbasis zum Bedarf in der freien Kulturarbeit schafft.

Presseaussendung von IG Kultur Österreich, IG Kultur Burgenland, IG KiKK - IG der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška, KUPF - Kulturplattform Oberösterreich, Dachverband Salzburger Kulturstätten, IG Kultur Steiermark, TKI - Tiroler Kulturinitiativen, IG Kultur Vorarlberg und IG Kultur Wien.
Zum ersten Mal hat es die Forderung nach FAIR PAY, also die Einführung einer angemessenen und fairen Bezahlung für alle im Kulturbereich Tätigen ohne Ausdünnung des kulturellen Angebots, in ein Regierungsprogramm geschafft. Um diesem Ziel näher zu kommen, braucht es nicht nur akut mehr Budget, sondern auch eine Faktenbasis. Denn bislang existieren weder solide Daten zum Ist-Zustand noch zum Finanzierungsbedarf, um nach Fair Pay entlohnen zu können.
Zwar wurde die soziale Lage der Künstler*innen in Österreich bereits zwei Mal erhoben, mit den wohl bekannten desaströsen Ergebnissen, die Situation der Kulturarbeiter*innen – also jener Menschen, die sich professionell in Kultureinrichtungen und Vereinen tagtäglich engagieren – wurde jedoch stets ausgeblendet und nicht erhoben. Dass aber auch im Bereich der Kulturinitiativen prekäre Verhältnisse vorherrschen, stellen die Interessenvertretungen im Zuge ihrer täglichen Arbeit seit Jahren fest.
Eine nicht-repräsentative Online-Umfrage aus dem Jahr 2013 ergab, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter*innen in Kulturinitiativen, die bezahlt werden (etwa 46% sind unbezahlt/ehrenamtlich tätig), höchstens 5.000 Euro im Jahr verdienen. Verabsäumt wurde bei dieser im Auftrag des Kunstressorts erstellten Erhebung jedoch, die Einkommensdaten in Bezug zur geleisteten Arbeitszeit zu setzen, sodass keine Aussagen zu Fair Pay möglich sind (Quelle: „Fair Pay – Eine Online-Umfrage zur finanziellen Situation freier Kulturinitiativen und -vereine“, 2013, erstellt von österreichische kulturdokumentation im Auftrag der Kunstsektion/BMUKK).
Als ersten Schritt in Richtung Fair Pay sollte die Bundesregierung daher eine österreichweite Erhebung beauftragen, die analysiert wie groß die Kluft zwischen echtem Fair Pay und den tatsächlichen Zuständen in den unabhängigen Kultureinrichtungen und Vereinen ist. Es braucht Fakten zum Finanzierungsbedarf bzw. zu der realen Finanzierungslücke, um bestehende Mitarbeiter*innen nach Fair Pay entlohnen zu können, Anstellungen zu ermöglichen und angemessene Honorare für selbstständige Tätigkeit zahlen zu können.
„Wer Fair Pay erreichen will, darf nicht auf einem Auge blind sein,“ so die Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, Yvonne Gimpel, „Es sind Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen gemeinsam, die das breite und vielfältige Kulturangebot in Österreich lebendig halten. Viel zu oft besteht die Herausforderung für Kulturinitiativen bereits darin, für professionelle Tätigkeiten überhaupt zahlen zu können, von Fair Pay ganz zu schweigen. Deswegen brauchen wir Fakten zum Finanzierungsbedarf in der freien Kulturarbeit.“
Die Interessenvertretungen freier Kulturarbeit können jahrelange Erfahrung dazu einbringen. Wir setzten darauf, dass Kulturstaatssekretärin Lunacek den angekündigten Dialog mit den Interessenvertretungen zeitnah sucht, damit Mindeststandards der Entlohnung auch im Kultursektor endlich Realität werden – ohne zu Lasten der Anzahl, Ausstattung oder Vielfalt in den geförderten Projekten zu führen.
Hintergrundinformation:
Gehaltsschema für Kulturvereine 2020, IG Kultur Österreich
Fair Pay Empfehlungen der IG Kultur Österreich als Grundlage für Einreichungen bei Fördergebern
Honorarspiegel für freiberufliche Kulturschaffende 2020, TKI – Tiroler Kulturinitiativen
Jährlich aktualisierter Fair Pay Honorarspiegel der TKI für freie, selbstständige Kulturarbeit
Fair Pay – Eine Online-Umfrage zur finanziellen Situation freier Kulturinitiativen und -vereine,
Endbericht Dezember 2013, erstellt von österreichische kulturdokumentation im Auftrag der Kunstsektion/BMUKK
Rückfragehinweise:
IG Kultur Österreich, Yvonne Gimpel
Telefon: +43 / 1 / 503 71 20
E-Mail: gimpel@igkultur.at