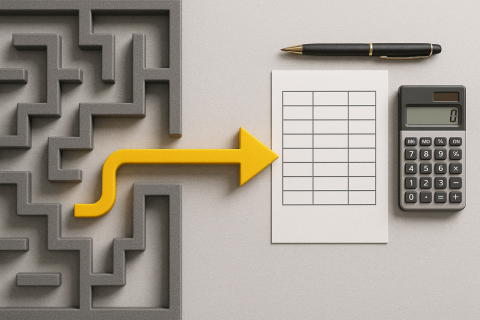Alles im Rahmen
Seit Jahren verbessern Kunst- und Kulturverantwortliche die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur. Demnach müßten sie sich eigentlich schon verbessert zeigen. Zum Beispiel, indem der für die Kunst- und Kulturvermittlung an Schulen eingerichtete Österreichische Kultur-Service keine gesponserten Jugendkochwettbewerbe als exemplarisch für seine Tätigkeit anführt, sondern Veranstaltungen mit Künstlern.
Seit Jahren verbessern Kunst- und Kulturverantwortliche die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur. Demnach müßten sie sich eigentlich schon verbessert zeigen. Zum Beispiel, indem der für die Kunst- und Kulturvermittlung an Schulen eingerichtete Österreichische Kultur-Service keine gesponserten Jugendkochwettbewerbe als exemplarisch für seine Tätigkeit anführt, sondern Veranstaltungen mit Künstlern.
Wo Rahmenbedingungen verbessert werden, kann auch die "Kreativwirtschaft" bzw. der Erfindungsreichtum der Wirtschaft, ständig neue Zugänge zu Konsumenten zu finden, nicht weit sein. Ein zeitgemäß agierender Kulturvermittler wie der Österreichische Kultur-Service weiß daher, worin seine Aufgabe besteht: "Wir eröffnen Unternehmen neue (!) innovative (!) Kommunikationsmöglichkeiten mit der gewünschten Zielgruppe."
Werbeagenturen, Personalvermittlern, PR-Managern und Finanzberatern hat sich mit der Betreuung von öffentlichen Kunst- und Kulturaufgaben ein neues Betätigungsfeld erschlossen. Das hat zwar für die Kunst- und Kulturförderung nichts gebracht und oft nicht einmal etwas mit Kunst und Kultur zu tun, aber dem wesentlich besser als dem Gros der Künstler honorierten Beraterwesen zu einer deutlichen Prestigesteigerung verholfen. Und es hat der Kultur- und Bildungspolitik viele lästige Auseinandersetzungen über die nicht mehr vorhandenen inhaltlichen Zielsetzungen erspart. Ein, in einem ganz anderen Sinn als dem gemeinten, "transparenter" Beleg dafür sind die soeben erschienenen Berichte über die Kunstförderungen des Bundes und die Kulturförderungen der Stadt Wien des Jahres 2002.
Ähnliche Berichte, wie der Kulturbericht des Bildungsministeriums und der Auslandskulturbericht, leisten, aus den die Kultur- und Bildungspolitik der letzten Jahre kennzeichnenden Gründen, nicht einmal das. Der Kulturbericht des Bildungsministeriums erscheint als weitgehend zahlenfreier Musterkatalog erfolgreicher Selbstdarstellungen, und der in Papierform mittlerweile inexistente Auslandskulturbericht bleibt mangels Auslastung mit Aktivitäten auf ein paar Hintergrundinformationen im Internetauftritt des Außenministeriums beschränkt.
Es spricht nicht für die Überzeugungsfähigkeit der vorgelegten Bilanzen, daß sie trotz vorweggenommener Amtszufriedenheit kaum Anklang gefunden haben und letztlich nur das Argument keiner oder keiner neuerlichen Ausgabeneinschränkungen als Erfolgsnachweis für sich in Anspruch nehmen können. An kulturpolitischen Maßstäben gemessen, sind sie selbstgenügsame Kompendien, die in erster Linie der Eigen-PR dienen. So schlägt sich das behauptete Interesse der Kulturpolitik der Stadt Wien an Künstlern hauptsächlich in medialen Ankündigungen nieder, in konkreten Zahlen sind es aber dann doch die Veranstalter des "Wiener Stadtfestes" und des "Donauinselfestes", die mit erhöhter Aufmerksamkeit rechnen dürfen.
Auf Bundesebene wird angeblich der Kulturentwicklung in den Regionen größere Beachtung geschenkt, von der die meisten Kulturveranstalter aber nur vom Hörensagen wissen, und die sich im wesentlichen auf die Eigenveranstaltertätigkeit des Kunststaatssekretariats von Kulturministertreffen und ähnlichen Kulturereignissen außerhalb Wiens beschränkt - Schmuck- und Feigenblatt-Aktionen eingeschlossen, die da- und dorthin exportiert werden und Kunst und Künstlern gewidmet sind. Letztlich aber dient alles dem einzigen über einer Weiterverwaltungshöhe angesiedelten Ziel des derzeitigen Regierungsprogramms: "die kulturellen Beziehungen zu den EU-Kandidatenländern und Südosteuropas zu verbessern". Oder wie es Franz Morak im ersten Satz des Bundeskunstberichtes 2002 ausdrückt: "Wer heutzutage die Meinung vertritt, daß die Kultur einen Beitrag zur europäischen Integration leisten kann, der erntet kaum Widerspruch."
Dieser Ansatz ist so alt wie die Vorbereitungen auf den österreichischen EU-Beitritt 1995 und auf die erste österreichische EU-Präsidentschaft 1998. Er unterscheidet sich auch nicht von Kultur- und Wirtschaftskooperationen, wie sich der Österreichische Kultur-Service solche Kooperationen vorstellt, er hat nur ein Ziel: Kunst und Kultur für Werbezwecke einzusetzen. Das kann man als von der Kunst- und Kulturförderung unabhängiges Interesse gelten lassen, nur nicht, wenn jemand meint, es handle sich dabei um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kunst, Kultur und Künstler.
Im Rahmen der eigentlichen Rahmenbedingungen für künstlerisches Arbeiten läßt sich nicht viel Positives finden. Kultureinspareffekte wie die Auflösung der österreichischen Kulturinstitute, der Verkauf des Österreichischen Bundesverlags, die Halbierung der Hörspiel-Autorenhonorare, die Wegrationalisierung der Landeskulturprogramme und der Sendeinhalte der "kunst-stücke" im ORF, die Streichung von Deutsch- und Unterrichtsstunden in den musischen Fächern, die Ersetzung des einzigen Österreich-Filmfestivals "Diagonale" durch ein Osteuropa-Filmfestival weisen in eine ganz andere Richtung. In eine Richtung, in der sich die Kunstförderung ebenfalls für wesentlich verbessert hält: in der stärkeren Direktförderung der Künstler, welche für diejenigen, die sie überhaupt bekommen, auch dringend erforderlich ist, wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Für die anderen 90 Prozent der Künstler, die nicht auch noch direkt gefördert werden können, gelten die "verbesserten" Rahmenbedingungen.
Dieser Text erschien als Gastkommentar im FALTER, Nr.29/03
Wo Rahmenbedingungen verbessert werden, kann auch die "Kreativwirtschaft" bzw. der Erfindungsreichtum der Wirtschaft, ständig neue Zugänge zu Konsumenten zu finden, nicht weit sein. Ein zeitgemäß agierender Kulturvermittler wie der Österreichische Kultur-Service weiß daher, worin seine Aufgabe besteht: "Wir eröffnen Unternehmen neue (!) innovative (!) Kommunikationsmöglichkeiten mit der gewünschten Zielgruppe."
Werbeagenturen, Personalvermittlern, PR-Managern und Finanzberatern hat sich mit der Betreuung von öffentlichen Kunst- und Kulturaufgaben ein neues Betätigungsfeld erschlossen. Das hat zwar für die Kunst- und Kulturförderung nichts gebracht und oft nicht einmal etwas mit Kunst und Kultur zu tun, aber dem wesentlich besser als dem Gros der Künstler honorierten Beraterwesen zu einer deutlichen Prestigesteigerung verholfen. Und es hat der Kultur- und Bildungspolitik viele lästige Auseinandersetzungen über die nicht mehr vorhandenen inhaltlichen Zielsetzungen erspart. Ein, in einem ganz anderen Sinn als dem gemeinten, "transparenter" Beleg dafür sind die soeben erschienenen Berichte über die Kunstförderungen des Bundes und die Kulturförderungen der Stadt Wien des Jahres 2002.
Ähnliche Berichte, wie der Kulturbericht des Bildungsministeriums und der Auslandskulturbericht, leisten, aus den die Kultur- und Bildungspolitik der letzten Jahre kennzeichnenden Gründen, nicht einmal das. Der Kulturbericht des Bildungsministeriums erscheint als weitgehend zahlenfreier Musterkatalog erfolgreicher Selbstdarstellungen, und der in Papierform mittlerweile inexistente Auslandskulturbericht bleibt mangels Auslastung mit Aktivitäten auf ein paar Hintergrundinformationen im Internetauftritt des Außenministeriums beschränkt.
Es spricht nicht für die Überzeugungsfähigkeit der vorgelegten Bilanzen, daß sie trotz vorweggenommener Amtszufriedenheit kaum Anklang gefunden haben und letztlich nur das Argument keiner oder keiner neuerlichen Ausgabeneinschränkungen als Erfolgsnachweis für sich in Anspruch nehmen können. An kulturpolitischen Maßstäben gemessen, sind sie selbstgenügsame Kompendien, die in erster Linie der Eigen-PR dienen. So schlägt sich das behauptete Interesse der Kulturpolitik der Stadt Wien an Künstlern hauptsächlich in medialen Ankündigungen nieder, in konkreten Zahlen sind es aber dann doch die Veranstalter des "Wiener Stadtfestes" und des "Donauinselfestes", die mit erhöhter Aufmerksamkeit rechnen dürfen.
Auf Bundesebene wird angeblich der Kulturentwicklung in den Regionen größere Beachtung geschenkt, von der die meisten Kulturveranstalter aber nur vom Hörensagen wissen, und die sich im wesentlichen auf die Eigenveranstaltertätigkeit des Kunststaatssekretariats von Kulturministertreffen und ähnlichen Kulturereignissen außerhalb Wiens beschränkt - Schmuck- und Feigenblatt-Aktionen eingeschlossen, die da- und dorthin exportiert werden und Kunst und Künstlern gewidmet sind. Letztlich aber dient alles dem einzigen über einer Weiterverwaltungshöhe angesiedelten Ziel des derzeitigen Regierungsprogramms: "die kulturellen Beziehungen zu den EU-Kandidatenländern und Südosteuropas zu verbessern". Oder wie es Franz Morak im ersten Satz des Bundeskunstberichtes 2002 ausdrückt: "Wer heutzutage die Meinung vertritt, daß die Kultur einen Beitrag zur europäischen Integration leisten kann, der erntet kaum Widerspruch."
Dieser Ansatz ist so alt wie die Vorbereitungen auf den österreichischen EU-Beitritt 1995 und auf die erste österreichische EU-Präsidentschaft 1998. Er unterscheidet sich auch nicht von Kultur- und Wirtschaftskooperationen, wie sich der Österreichische Kultur-Service solche Kooperationen vorstellt, er hat nur ein Ziel: Kunst und Kultur für Werbezwecke einzusetzen. Das kann man als von der Kunst- und Kulturförderung unabhängiges Interesse gelten lassen, nur nicht, wenn jemand meint, es handle sich dabei um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kunst, Kultur und Künstler.
Im Rahmen der eigentlichen Rahmenbedingungen für künstlerisches Arbeiten läßt sich nicht viel Positives finden. Kultureinspareffekte wie die Auflösung der österreichischen Kulturinstitute, der Verkauf des Österreichischen Bundesverlags, die Halbierung der Hörspiel-Autorenhonorare, die Wegrationalisierung der Landeskulturprogramme und der Sendeinhalte der "kunst-stücke" im ORF, die Streichung von Deutsch- und Unterrichtsstunden in den musischen Fächern, die Ersetzung des einzigen Österreich-Filmfestivals "Diagonale" durch ein Osteuropa-Filmfestival weisen in eine ganz andere Richtung. In eine Richtung, in der sich die Kunstförderung ebenfalls für wesentlich verbessert hält: in der stärkeren Direktförderung der Künstler, welche für diejenigen, die sie überhaupt bekommen, auch dringend erforderlich ist, wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Für die anderen 90 Prozent der Künstler, die nicht auch noch direkt gefördert werden können, gelten die "verbesserten" Rahmenbedingungen.
Dieser Text erschien als Gastkommentar im FALTER, Nr.29/03