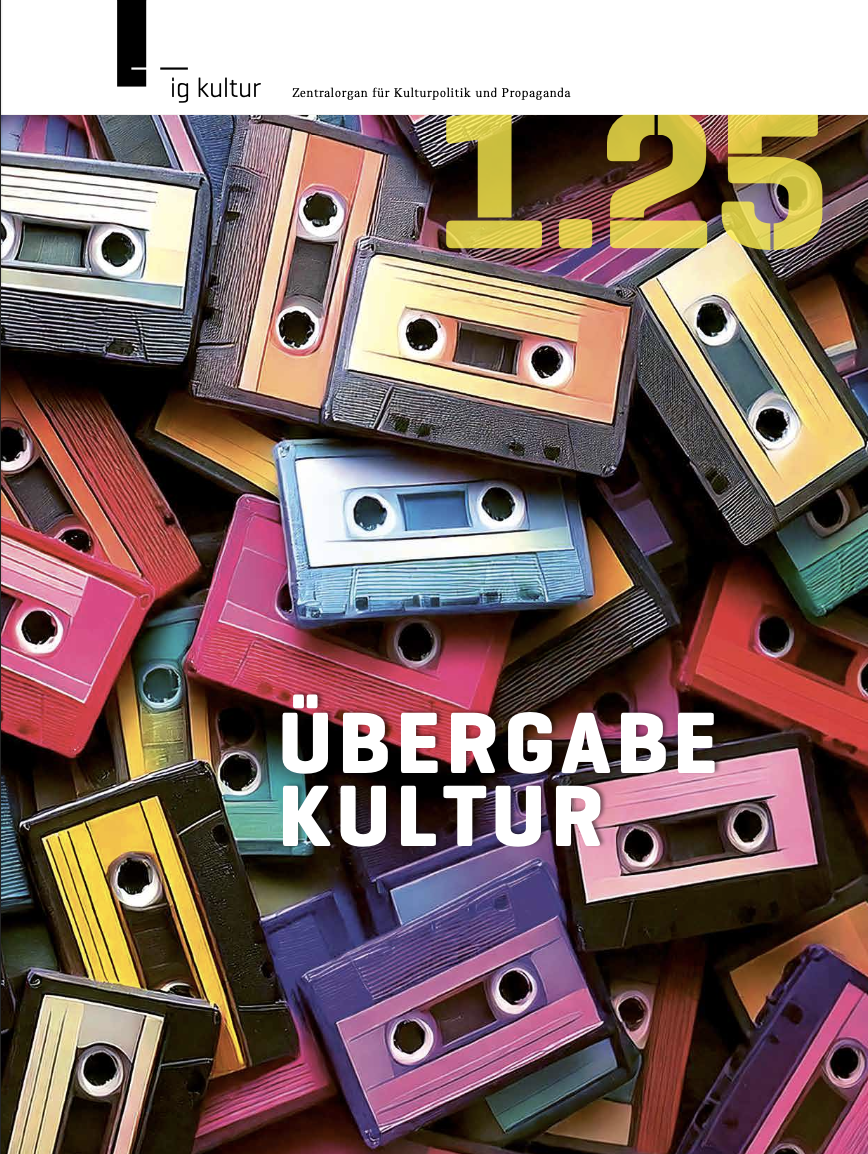Die Zukunft ist ungewiss, aber eins steht fest: Die Welt gibt es nicht mehr, aus der heraus wir – die jetzt abtretende Generation der Kultur(be)treibenden – einst die Kulturzentren und -häuser gegründet haben. Der anstehende Generationswechsel stellt deshalb nicht nur die Frage nach geeigneten Übergängen, sondern auch danach, in welche Welt hinein die Zentren in den nächsten Jahren entwickelt werden müssen. Wie sieht die Welt in 25 Jahren aus und wie kann Soziokultur in dieser Zukunft verortet werden?
Der Generationswechsel sollte also mit Weitsicht geplant werden. Weitsicht heißt im Englischen foresight und dies bezeichnet auch einen Wissenschaftsansatz, mit dem man mögliche und wahrscheinliche Zukünfte zu erkennen versucht. Bei Foresight-Prozessen geht es nicht um das Hellsehen, sondern um das Erkennen von Megatrends, den „Tiefenströmungen des Wandels“, die jetzt schon unsere Gesellschaft verändern.
Schaut man sich die meistgenannten Megatrends der Forschungsinstitute an, trifft man auf viele alte Bekannte: Überalterung der Gesellschaft, Erdüberhitzung oder zunehmende Bedeutung des Wissens. Doch hinter diesen bekannten Schlagwörtern verbergen sich Megatrends, die unsere materiellen Lebensbedingungen radikal verändern und damit das materielle Umfeld, in dem Kultur produziert wird. Es geht also nicht um neue Themen in der Kulturarbeit, sondern um die Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um die materiellen Grundlagen der zukünftigen soziokulturellen Arbeit.
Der demografische Wandel etwa bedeutet nicht nur Überalterung der Gesellschaft, sondern auch, dass Jugend zukünftig eine Randgruppe sein und nicht mehr im Fokus gesellschaftlicher Aufmerksamkeit stehen wird.
In den Arrival-Quartieren der größeren Städte werden junge migrationserfahrene Menschen eine wachsende Gruppe darstellen, die aufgrund des Megatrends „Überalterung“ aber nicht die entsprechende Aufmerksamkeit genießen. Teile dieser young urbans of color werden maßgebliche Treiber einer neuen europäisch-islamischen Kultur sein, die sich von den islamischen Gesellschaften der arabischen Welt ebenso unterscheidet wie von den calvinistisch-lutherisch geprägten Bildungsbürger*innen Nordeuropas.
Überhaupt wird „Superdiversity“ eine starke Rolle für die Städte spielen. Superdiversity, ein Begriff des Soziologen Steven Vertovec, beschreibt eine in unzählige Untergruppen zersplitterte Gesellschaft, die über jeweils ungleiche rechtliche, soziale, politische und ökonomische Zugänge verfügen. Diversität basiert nicht auf Herkunft, Sprache oder Religion, sondern auf unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten, die durch geltendes Recht, rassistische Diskurse, postkoloniale Konstruktionen oder über Stereotype definiert werden. Die postmigrantische Gesellschaft erfordert eine Kulturarbeit, die sich radikal von dem Gestus „Kultur für …“ verabschiedet und Bühne und Regiesessel frei macht für eine superdiverse Gesellschaft.
Der mächtigste Treiber in die zukünftige Gesellschaft scheint die digitale Revolution zu sein. Immer schnellere und komplexere digitale Möglichkeiten treiben die Menschen vor sich her. In der Kulturarbeit werden häufig die daraus resultierenden Ängste oder der angebliche Verfall der Öffentlichkeit thematisiert. Es kommt aber darauf an, eine neue hochkomplexe Öffentlichkeit zu gestalten und einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem digitale und analoge Welten zunehmend und in Echtzeit verkoppelt werden. Hier öffnet sich ein riesiges Aufgabenfeld für die Soziokultur.
Wissen ist ein kostbarer Rohstoff. Soziale Kämpfe werden zukünftig auch als Kämpfe um Zugang zur Ressource Wissen ausgetragen.
Soziokulturelle Arbeit wird Öffentlichkeit neu definieren müssen
Eine soziokulturelle Arbeit, die sich im Kern auf die Öffentlichkeit bezieht, wird diese neu definieren müssen. Wie sehen kulturelle Zentren aus in einer Gesellschaft, in der Ethnie oder Nationalität eine immer geringere Rolle spielen und wo die Organisation der Individuen zunehmend in Netzwerken stattfindet, und zwar in analogen und digitalen. Wie müssen wir zukünftig städtischen Raum, Diversität, Interaktivität neu ausdeuten?
Das „Internet der Dinge“, also die Erweiterung der Kommunikation der Menschen durch das Geplauder der Maschinen untereinander, stellt uns vor weitere Fragen: Was ist Kommunikation? In welchem Raum kommunizieren wir? Soziokultur, die sich einem emanzipatorischen erweiterten Bildungsideal verbunden fühlt, wird sich auch auseinandersetzen müssen mit einem radikalen Wandel der Bildungsprozesse und -inhalte. Wissen ist ein kostbarer Rohstoff. Soziale Kämpfe werden zukünftig auch als Kämpfe um Zugang zur Ressource Wissen ausgetragen.
Wenn der Generationswechsel gelingen soll, dann brauchen wir Leitungsteams, die sich mit diesen Fragen intensiv auseinandersetzen und vor allem eins nicht tun dürfen: Alles so weitermachen, wie wir es begonnen haben.
Lutz Liffers ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Vereins Kultur Vor Ort e.V. in Bremen-Gröpelingen.
Coverbild: © Michael Dziedzic via Unsplash
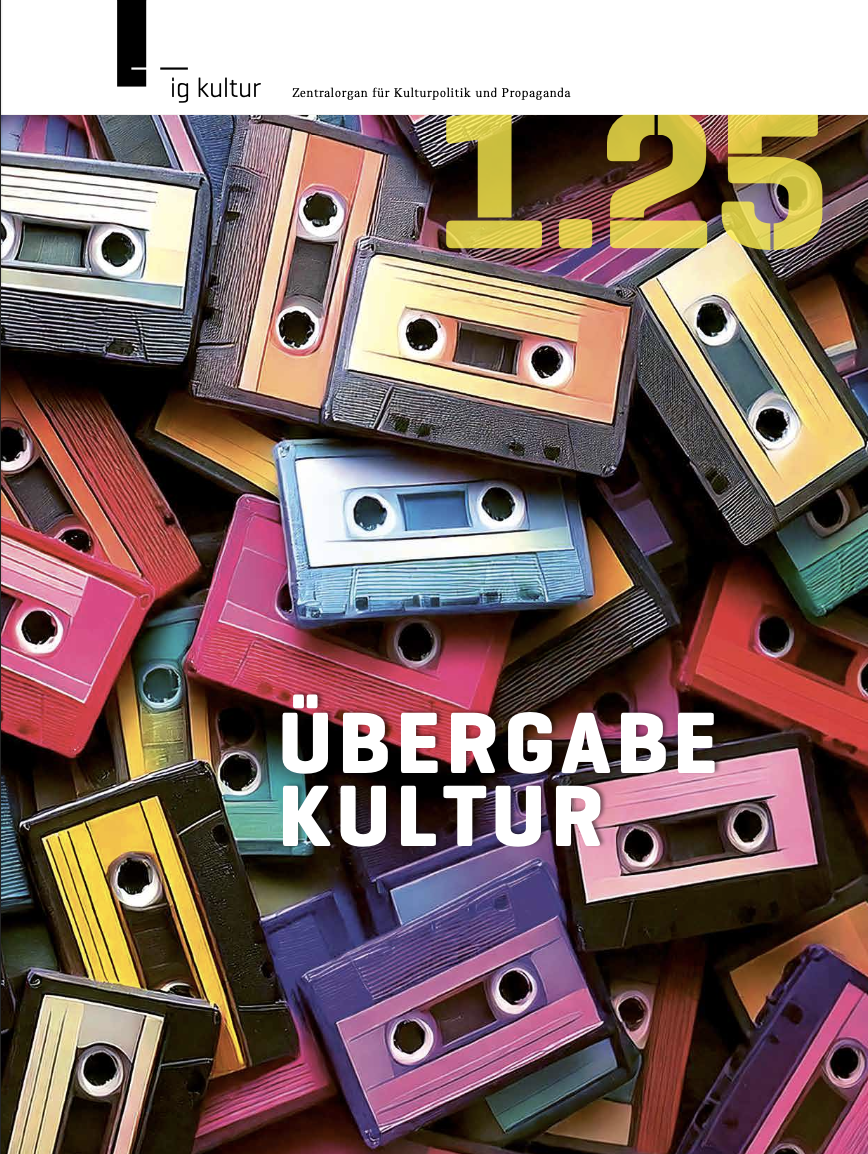
Erschienen im Magazin "Soziokultur 3/17".
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Bundesvereingung Soziokultureller Zentren in der Ausgabe 1.25 „ÜBERGABE KULTUR“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda.
Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5,50 €) bestellt werden.