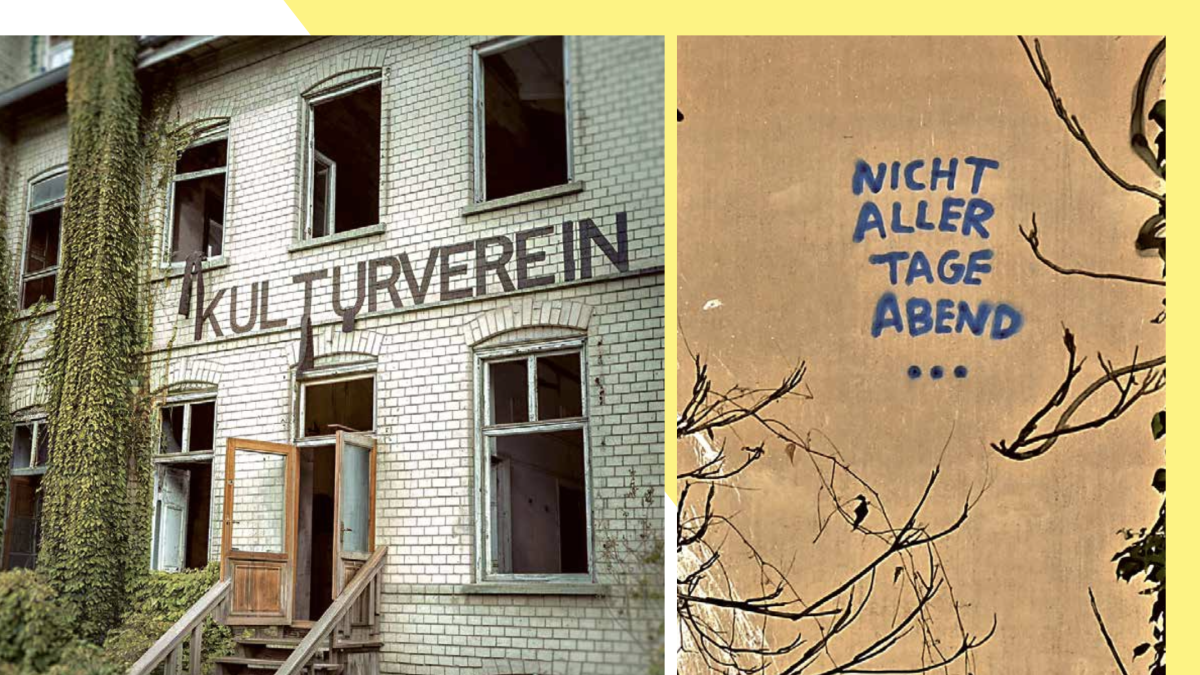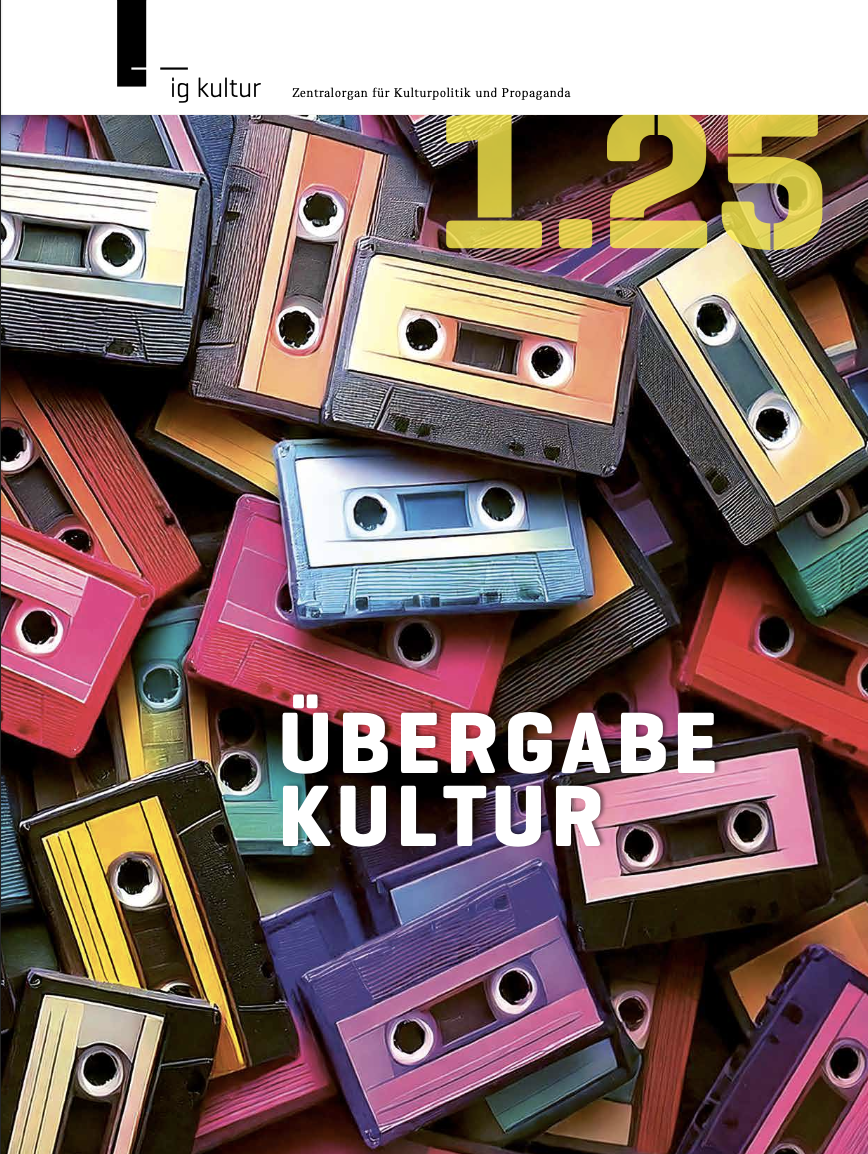...aber wie soll es dann weitergehen?
Diese zentrale Frage beschäftigt früher oder später alle Kulturinitiativen. Besonders relevant ist sie derzeit für jene zahlreichen Vereine, die in den 1990er-Jahren und rund um die Jahrtausendwende ins Leben gerufen wurden, als die autonome, soziokulturelle Szene ein starkes Wachstum verzeichnete. Die kulturelle und künstlerische Landschaft in Österreich wird auch heute noch maßgeblich von diesen Initiativen und Vereinen, die zu einem großen Teil noch immer von den Gründer*innen geleitet werden, geprägt. Eine zentrale Herausforderung besteht nun darin, wie man eine neue Generation von Kulturarbeiter*innen und Künstler*innen nachhaltig in diese etablierten und doch häufig in ihrer Existenz bedrohten Strukturen einbinden kann, sodass diese den Erfolg langjähriger Arbeit fortsetzen und in die Zukunft weiter tragen können.
Die Frage der Nachfolge stellt sich dabei als kein einfaches Unterfangen dar – insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Anforderungen an Kulturarbeit, die strukturellen Gegebenheiten und Denkweisen grundlegend gewandelt haben. Vielmehr erfordert die Übergabe umfangreiches Wissen und vielfältige Ressourcen, denn sie verläuft nicht immer reibungslos. Sie ist ein komplexer Prozess, der Konfliktpotenzial birgt und in Anbetracht dieser Spannungsfelder sorgfältiger Planung und Überlegung bedarf – ähnlich der Übergabe von Familienbetrieben oder Wirtschaftsunternehmen.
Auf Basis vieler Gespräche mit Personen aus Kulturinitiativen, die sich in einem Übergabeprozess befinden oder einen solchen bereits durchlaufen haben, wird nachfolgend dargestellt, welche zentralen Fragen sich die beteiligten Akteur*innen stellen sollten bzw. mit welchen Herausforderungen und Konfliktlinien sie sich im Zuge der Vereinsübergabe besonders häufig konfrontiert sehen und welche Bewältigungsstrategien hilfreich sein können.
Die Frage des „Wer?“ – die Vereinbarkeit unterschiedlicher Perspektiven
Die wohl wichtigste Frage ist jene nach dem „Wer?“. Wer übergibt und wer soll übernehmen? Wird an Personen übergeben, die schon lange in die Vereinsaktivitäten eingebunden und mit diesen vertraut sind, oder werden gezielt neue Personen von außen dazugeholt? Beide Varianten erfordern eine gänzlich andere Herangehensweise an die Übergabe, da die Nachfolge im ersteren Fall auf einer bereits bestehenden Basis sozusagen organisch aufgebaut werden kann, während diese Basis im zweiteren Fall erst geschaffen werden muss.
Eine weitere Frage im Zusammenhang mit dem „Wer?“ sollte dahingehend gestellt werden, ob die Leitung an Einzelpersonen oder ein Kollektiv übergeben wird. Aktuell ist ein Trend weg vom Individualismus hin zu kollektiveren, demokratischeren Strukturen zu beobachten, die auf eine geteilte Verantwortung wie auch eine geteilte Sichtbarkeit abzielen. „Kollektiv und nachhaltig“ entspricht einem Zeitgeist – eine Entwicklung, die speziell im Hinblick auf Generationenübergaben von hoher Relevanz ist, denn allzu oft stehen Kulturinitiativen vor dem Problem einer Überidentifikation mit einzelnen Persönlichkeiten. Dass die jeweils beteiligten Menschen die inhaltliche und organisationale Ausrichtung einer Kulturinitiative prägen, sei hier nicht in Frage gestellt, aber es gilt, einen Verein mehr strukturell und weniger als persönliche Sache von Einzelpersonen zu denken. Eine zu starke Überidentifizierung mit einer Person wird spätestens dann problematisch, wenn diese ausfällt bzw. wenn der Verein vor der Nachfolgefrage steht. Es stellt sich im Zuge von Übergabeprozessen also die zentrale Frage, ob sich die bestehenden Strukturen für eine kollektive Leitung eignen und wenn nicht, wie die Organisation so strukturiert werden kann, dass sie als Entität unabhängig von gewissen Individuen lebensfähig bleibt.
Unabhängig davon, ob der Verein an bereits involvierte oder neue Personen, an Einzelpersonen oder eine kollektive Leitung übergeben wird, sind die wohl wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem „Wer“ aber wahrscheinlich die folgenden: Wer sind die beteiligten Personen? Welche Hintergründe und damit einhergehenden Perspektiven bringen sie mit? Welche möglicherweise differierenden Erwartungshaltungen haben sie und wie sind diese miteinander vereinbar? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen sollte den gesamten Übergabeprozess rahmen und bedarf einer laufenden Reflexion sowie offenen Kommunikation, denn gerade dieses Spannungsfeld der unterschiedlichen Perspektiven und Erwartungen birgt ein hohes Konfliktpotenzial – viele Vereinsübergaben scheitern genau daran.
Vor diesem Hintergrund ist es essentiell, die Übergabethematik nicht nur generationell im Sinne einer Übergabe an „Jüngere“ zu betrachten, sondern in einem Kontext der Intersektionalität und Diversität. Die Generationenfrage ist vielschichtig und umfasst auf beiden Seiten verschiedenste Erwartungshaltungen, die einer sorgfältigen Auseinandersetzung und auf Gegenseitigkeit beruhender Offenheit sowie Aufmerksamkeit bedürfen. Nachfolgende Generationen weisen häufig völlig andere Erfahrungswerte und damit einhergehende Erwartungshaltungen auf als die Generation der Gründer*innen. Aus vielen Gesprächen ist hervorgegangen, dass die sich massiv im Wandel befindenden Sozialisationsmuster und damit einhergehende differierende Perspektiven der Akteur*innen teilweise erhebliches Konfliktpotenzial bergen. Dieses tritt beispielsweise in Form unterschiedlicher Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht und damit einhergehende Rollenzuschreibungen oder in der unterschiedlich stark wahrgenommenen Notwendigkeit, dass die gesellschaftliche Diversität sich auch in organisationalen Strukturen widerspiegeln sollte, zu Tage. Mit der Frage des „Wer“ sollten dahingehend immer auch Fragen der Gleichstellung, Gleichbehandlung und Diversität mitgedacht werden.
Die Frage des „Was?“ – die Schwierigkeit loszulassen und die Übernahme von Verantwortung
Die zweite große Kernfrage ist jene nach dem „Was?“. Diese erscheint bei der Übergabe eines Vereins zunächst offensichtlich, doch beim genaueren Hinschauen wird klar, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss. Gerade bei künstlerischen Vereinen stellt sich immer auch die zentrale Frage, was überhaupt übergeben werden soll: Werden lediglich die Vereinsstrukturen sowie das vorhandene Budget weitergereicht oder aber auch die inhaltliche Ausrichtung bzw. eine Vision? Wie wird sozusagen mit dem inhaltlichen „Erbe“, also der bisherigen Arbeit des Vereins bzw. der involvierten Personen umgegangen? Inwieweit soll bzw. kann dieses in die Zukunft getragen und weitergeführt oder neu ausgerichtet werden?
Die Übergabe eines Vereins, speziell wenn die Generation der Gründer*innen sich verabschiedet, hat immer auch eine emotionale Dimension, die nicht übersehen werden sollte. Oft wurde jahre- oder sogar jahrzehntelang mit viel persönlichem Einsatz etwas aufgebaut und gestaltet – vergleichbar mit einem Kind, das man großgezogen hat. Das Loslassen fällt daher nicht immer leicht und dennoch ist es wichtig oder vielmehr sogar notwendig, wenn die nächste Generation Rahmenbedingungen vorfinden soll, welche es erlauben, die Arbeit erfolgreich fortsetzen bzw. auch inhaltlich oder strukturell neu ausrichten zu können. Hier ist gegenseitiges Vertrauen gefragt.
Im Optimalfall erfolgt die Weitergabe aus einer Position der Stärke, nicht aus einer Position der Erschöpfung bzw. des Verfalls.
Vor dem Hintergrund, dass häufig bereits etablierte Strukturen mit vorhandenem Budget, Infrastruktur und Netzwerken übergeben werden, lässt sich auf der Seite der Übergebenden manchmal eine Haltung im Sinne eines „Ihr habt es ja viel leichter!“ beobachten. Umgekehrt sieht sich die nachfolgende Generation aber häufig starren Strukturen gegenüber, die Eigeninitiative, neue Ideen oder ganz allgemein Veränderungsprozesse gar nicht oder nur schwer zulassen. Bei der Frage des „Was wird übergeben?“ darf dabei nicht vergessen werden, dass spätestens mit der Übernahme der formellen Strukturen auch die Verantwortung an die neuen Akteur*innen übergeht. Ein offener Austauschprozess darüber, ob mit dieser Verantwortungsübernahme zugleich auch die Freiheit der inhaltlichen Ausrichtung der weiteren Arbeit einhergehen soll, ist essentiell, um die jeweiligen Erwartungshaltungen aller Beteiligten offenzulegen und Konflikten vorzubeugen. Diesbezüglich ist eine Auseinandersetzung mit den Organisationsstrukturen sehr wichtig – von der Festlegung der übergeordneten Vision über daraus abgeleitete Ziele bis hin zu konkreten Tätigkeitsfeldern und der Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen allen Akteur*innen.
Die Fragen des „Wann?“ und „Wie?“ – das Fehlen von Ressourcen
Jede Vereinsübergabe braucht Ressourcen in Form von Zeit, Geld und vor allem auch Wissen. Betreffend die Zeit stellt sich dabei zunächst die Frage, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Antwort darauf ist stets eine individuelle und wird von Verein zu Verein variieren. Grundsätzlich lässt sich aus der Erfahrung allerdings festhalten, dass sich die aktuelle Leitung eines Vereins idealerweise schon Gedanken zur Nachfolge macht, wenn selbst noch mit Motivation und Freude gearbeitet wird und genügend Energie für den Übergabeprozess vorhanden ist, denn dieser braucht Zeit. Im Optimalfall erfolgt die Weitergabe aus einer Position der Stärke, nicht aus einer Position der Erschöpfung bzw. des Verfalls. Sind potentielle Nachfolger*innen bereits in den Verein involviert und signalisieren, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, sollte diese Gelegenheit jedenfalls als Chance begriffen und genutzt werden, sodass eine Übergabe nach und nach vollzogen werden kann. Denn eines ist sicher: Ein Team aufzubauen, braucht Zeit. Verständnis für die Initiative aufzubauen, braucht Zeit. Wissen weiterzugeben, welches zur Leitung eines Vereins benötigt wird, braucht Zeit.
Eine Übergabe kann nicht von heute auf morgen passieren. Sie bedarf guter Vorbereitung und im Idealfall auch moderierter, externer Begleitung – ein neutraler Blick von außen kann viel zur Auflösung bzw. Vorbeugung von Konflikten beitragen. Es gilt, sich mit einer Vielzahl an Fragen auseinanderzusetzen: Welche Schritte gehören zum Prozess der Übergabe? Welche rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Aspekte sind zu beachten? Was muss alles gelernt werden? Welche Gespräche sind zu führen? Wen sollte man alles kennengelernt haben? Wie schafft man eine Dokumentation, die Wissen und Informationen strukturiert weitergibt? Wie können die Mitglieder oder auch das Publikum gut in den Prozess integriert bzw. mitgenommen werden? Welche Ressourcen sind für den Übergabeprozess selbst und die Zeit danach vorhanden?
Kommunikation ist der Schlüssel – es ist wichtig, Wünsche, Zielvorstellungen und Bedürfnisse zu artikulieren, und es ist fast noch wichtiger, Reibungspunkte, unerfüllte Erwartungen und vor allem auch persönliche Grenzen an- bzw. auszusprechen.
Eine intensive Beschäftigung mit diesen Fragen ist insbesondere auch deshalb wichtig, da sich die Vorstellungen in Bezug auf professionelles Arbeiten oder auch die eigene Lebensgestaltung im Sinne einer Work-Life-Balance in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Auch hierin lassen sich potentielle Konfliktlinien verorten, die sich beispielsweise durch unterschiedliche Perspektiven und Ansprüche der übergebenden und übernehmenden Generation äußern können. Das Arbeiten im Verein sieht sich heute mit einer Vielzahl steigender Anforderungen konfrontiert: das Vereins- und Arbeitsrecht hat sich massiv gewandelt, die Vorgaben und Richtlinien zur Durchführung von Veranstaltungen und Co. werden laufend komplexer. Professionalität und rechtliches Wissen sind nicht mehr nur wünschenswerte Eigenschaften, sondern unverzichtbare Voraussetzungen, um als Kulturverein längerfristig bestehen bzw. erfolgreich arbeiten und gleichzeitig den vielfältigen Erwartungen der Fördergeber*innen und des Publikums gerecht zu werden. Erst dies ermöglicht eine gewisse ökonomische Stabilität, welche Veränderungsprozesse enorm erleichtert.
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei gemeinnützigen Kulturvereinen in den meisten Fällen um prekäre Akteur*innen handelt, ist dies als zunehmende Herausforderung zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es hier wichtig, Klarheit zu schaffen: Kann professionelle Begleitung durch Coaching oder Moderation finanziert werden? Welche Zukunftsperspektiven und Sicherheiten kann der Verein bieten? Welche Möglichkeiten der Vergütung sind gegeben? Sind längerfristige Anstellungen möglich? Muss die Arbeit auf ehrenamtlicher Basis erfolgen? Transformationsprozesse bergen stets Unsicherheiten und Risiken – eine Herausforderung in Zeiten zunehmender Professionalisierung und steigenden wirtschaftlichen Drucks, in der Karrierewege oft bereits durchgeplant sein sollten. Fehlende Mittel für strukturierte Übergabeprozesse und Planungssicherheit sind hier also sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene als höchst problematisch anzusehen und stellen eine klare politische Forderung im Hinblick auf ein angemessenes Kulturbudget dar. Der generationenübergreifende Wissenstransfer und die systematische Dokumentation von Informationen erfordern schlichtweg Ressourcen.

Klarheit schaffen, offen kommunizieren und loslassen
So wie jeder Kulturverein ein Unikat darstellt, ist auch jeder Übergabeprozess einzigartig. Es gibt keine universelle Lösung, wie ein Generationenwechsel erfolgreich gelingen kann. Die Strategien müssen an die jeweiligen Rahmenbedingungen, Charakteristika, Persönlichkeiten und Strukturen angepasst werden. Besonders gemeinnützige Vereine, die zu einem Großteil auf ehrenamtlicher Arbeit basieren, stehen dabei meist vor der Herausforderung, neben der regulären Tätigkeit auch noch Zeit und Ressourcen für Nachfolgeplanung und Übergabe erübrigen zu können. Im Hinblick auf die geschilderten Konfliktlinien und Spannungsfelder existieren aber durchaus Strategien bzw. Herangehensweisen, die unabhängig aller Unterschiede dabei helfen, diese abzuschwächen.
Zunächst ist es sinnvoll, ein geplantes sowie schrittweises Vorgehen zu wählen. Eine erste universelle Strategie, die jeden Übergabeprozess erleichtert, ist die Definition klarer Strukturen, Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten. Menschen, die schon lange tun, was sie tun, wissen oft gar nicht, was sie eigentlich alles machen. Oft unterschätzen langjährige Akteur*innen den Umfang ihrer Tätigkeiten – eine Definition der Arbeitsfelder ist daher essentiell. Spätestens bei der Übergabe braucht es dahingehend Klarheit. Dabei sollte jedenfalls auch eine Prüfung und etwaige Überarbeitung der bestehenden Statuten stattfinden sowie im Bedarfsfall beispielsweise eine Geschäftsordnung ausgearbeitet werden, welche die bereits erwähnten Verantwortlichkeiten klar regelt. Dies trägt einerseits zu rechtlicher Sicherheit sowie zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen bei und beugt andererseits Missverständnissen sowie Überforderung vor.
Idealerweise entsteht im Zuge eines Übergabeprozesses ein generationenübergreifender Austausch, der auf gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung sowie auf wechselseitigem Vertrauen und Verständnis beruht. Dies kann gelingen, indem das Potential des Voneinander-Lernens anerkannt und aktiv versucht wird, immer wieder die Perspektive des Gegenübers einzunehmen sowie die eigene Rolle bzw. besonders auch die eigene Erwartungshaltung zu reflektieren und diese auch offen zu kommunizieren. Die Ausgangsfrage kann dabei für alle beteiligten Akteur*innen die folgende sein: Was darf, was will und was kann ich in die Organisation einbringen? Kommunikation ist der Schlüssel – es ist wichtig, Wünsche, Zielvorstellungen und Bedürfnisse zu artikulieren, und es ist fast noch wichtiger, Reibungspunkte, unerfüllte Erwartungen und vor allem auch persönliche Grenzen an- bzw. auszusprechen. Passiert dies nicht, besteht die Gefahr, dass sich Frustration und damit ein Konfliktpotenzial aufbaut, welches nach und nach ein Gegeneinander anstelle eines Miteinanders bedingt. Ein klares „Ich kann nicht.“ ist jedenfalls konstruktiver als eine unausgesprochene Überforderung. Dahingehend sollte mit einer offenen Kommunikations- und Feedbackkultur unbedingt auch eine offene Fehlerkultur einhergehen, denn ein Übergabeprozess ist herausfordernd und komplex. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern sowie die klare Artikulation von Bedürfnissen und Erwartungen sind somit zentrale Strategien, die einen Generationenwechsel im Verein jedenfalls erleichtern.
Das allerwichtigste Element eines jeden Übergabeprozesses, das abschließend nochmals betont werden soll, ist aber wohl das Loslassen. Wenn der nachfolgenden Generation kein Spielraum und keine Perspektive zur Umsetzung eigener Ideen gegeben wird, sind alle Nachfolgebemühungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Wenn die bisherige Leitung nicht dazu in der Lage ist, loszulassen, wenn sie keine Veränderung erlaubt, wenn sie nicht zulassen kann, dass Dinge auch anders passieren können, ergibt sich daraus die ambivalente Situation, dass gerade die Furcht davor, die eigene Arbeit loszulassen, dieser schließlich ein Ende setzt.
Bettina Mair ist Soziologin und Kulturarbeiterin. Sie ist Mitbegründerin des Vereins awaGraz sowie des Grazer Techno-Kollektivs Ultra Flair und bei der IG Kultur Steiermark u.a. im Bereich Beratung sowie Mitgliederbetreuung tätig.
Coverbild und Fotos: © Bettina Mair
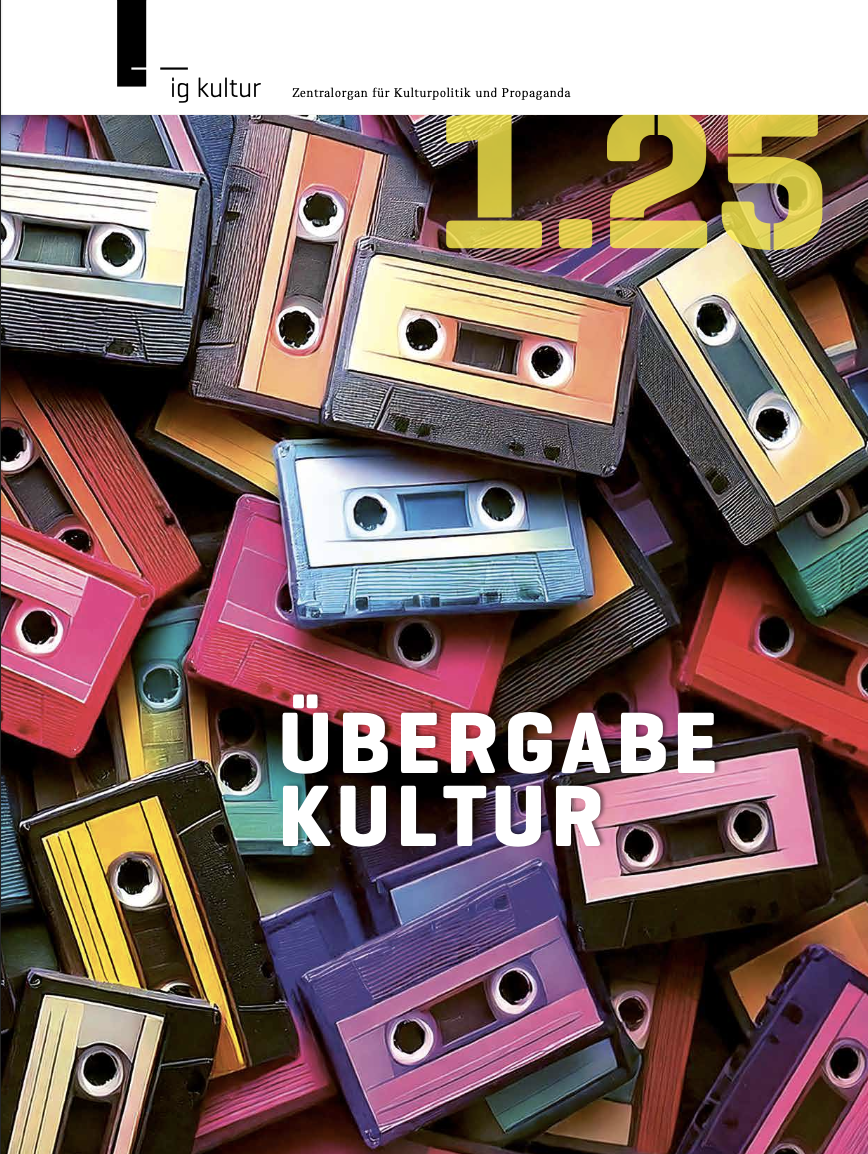
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.25 „ÜBERGABE KULTUR“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.
Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5,50 €) bestellt werden.