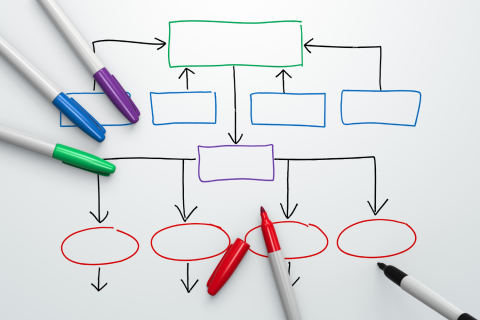Zur Lage der Kulturpolitik. Eine Bestandsaufnahme
Von A wie Absicherung bis Z wie Zugangsbarrieren. In einem gemeinsamen Kommuniqué legen Interessensverbände der Kunst- und Kulturschaffenden ihre Analyse zum Stand der Kulturpolitik in Österreich dar. Ausgangspunkt sind die internationalen Verpflichtungen, die Österreich mit Beitritt zur „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ eingegangen ist.

Ende letzten Jahres analysierten VertreterInnen von Kunst-, Kultur- und Medienschaffenden den Stand der Umsetzung der „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ in Österreich. Eingeladen dazu hatte die Österreichischen UNESCO-Kommission im Rahmen der „Klausurtagung Kulturelle Vielfalt“, um der Stimme der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung dieses internationalen Abkommens in Österreich Gehör zu verschaffen.
Das Ziel der UNESCO-Konvention, die als Schablone für die Analyse der kulturpolitischen Entwicklungen diente, ist einfach zusammengefasst: Kunst und Kultur sollen vor dem zunehmenden Kommerzialisierungszwang geschützt werden. Die Kulturpolitik soll Rahmenbedingungen schaffen, die gegen eine Musealisierung und Eventisierung konkrete Schritte setzt und zeitgenössisches Kunst- und Kulturschaffen in ihrer Vielfalt ermöglicht, unabhängig davon, ob sich damit Profite am Markt erwirtschaften lassen oder nicht. Ebenso soll die gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe aller am kulturellen Leben ermöglicht werden. Kurzum: die Förderung von Kunst und Kultur soll als demokratiepolitischer Auftrag und nicht nur als Wirtschafts- und Standortförderung verstanden werden.
Das Ergebnis dieser Analyse wurde nun in einem gemeinsamen Schlusskommuniqué veröffentlicht – unterstützt von einer breiten Allianz an Interessensvertretungen des Kultursektors (u.a. Dachverband der Österreichischen Filmschaffenden, Künstlerhaus/Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler, IG Autorinnen Autoren, IG Freie Theater, IG Kultur Österreich, IG Übersetzerinnen Übersetzer und Österreichischer Musikrat).
Im Fokus der Analyse standen die Themenbereiche:
- österreichische Kunst- und Kulturpolitik
- soziale Lage von Kunst- und Kulturschaffenden und Urheber*innenrecht
- Entwicklungen in der EU-Kulturpolitik
- Medienvielfalt und öffentlich-rechtliche Medien
- kulturelle Bildung
- Mobilität von Kunst- und Kulturschaffenden und Visabestimmungen
Der Befund ist eindeutig, wenn auch wenig überraschend: In keinem der analysierten Bereiche ließen sich substantielle Verbesserungen der kulturpolitischen Rahmenbedingungen feststellen.
Die zunehmende Ökonomisierung des Kunst- und Kulturbereichs, die ignorierte Prekarisierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kunst-, Kultur- und Medienschaffenden, die Schwächung öffentlich-rechtlicher wie freier gemeinnütziger Medien, die radikale Abschottungspolitik mit Verschärfungen im Visa- und Fremdenrecht und die Zurückdrängung kultureller Bildung im Schulsystem stehen im Widerspruch zu den Verpflichtungen, die Österreich mit Beitritt zur UNESCO-Konvention eingegangen ist.
Es besteht dringender Handlungsbedarf, so das Fazit des Schlusskommuniqués. Immerhin hat sich die aktuelle schwarz-blaue Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm ausdrücklich zur UNESCO-Konvention bekannt. Ein Bekenntnis am Papier reicht jedoch nicht aus. Es braucht konkrete Maßnahmen. Und es braucht den Austausch darüber.
Denn auch dies ist ein zentraler Vertragsgegenstand der von Österreich unterzeichneten Konvention: Die „aktive Einbindung der Zivilgesellschaft in alle die Konvention betreffenden Angelegenheiten.“ Ein Austausch mit den politischen Verantwortlichen auf Bundesebene hat bislang – über ein Jahr nach Regierungsantritt – trotz zahlreicher Anfragen jedoch nicht stattgefunden.
Auszüge aus dem Kommuniqué:
„Ein Umfeld, das Kunst- und Kulturschaffende in ihren Tätigkeiten unterstützt und bestärkt... kann angesichts der realen Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kunst- und Kulturschaffenden nach wie vor in Österreich nicht ausreichend verortet werden.“
„Faire Bezahlung ist aufgrund fehlender Kostenwahrheit in der Förderpraxis praktisch nirgends möglich, betroffen davon sind nicht nur Kunst- und Kulturschaffende, sondern auch Kulturarbeiter*innen sowie Kulturinitiativen und -vereine.“
„Im Bereich der Fördermittel ist eine mangelnde Indexierung und Anpassung eben dieser [Fördermittel] gleichermaßen problematisch wie eine gering ausgeprägte Flexibilität der Förderstrukturen.“
Hinsichtlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk „geht es um Inhalte und um die Ausgestaltung eines ORF-Gesetztes, das Medienvielfalt, Vielfalt der Programme, gesellschaftliche Relevanz, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit garantiert.“
Notwendig ist „ein radikales Umdenken in der österreichischen Bildungspolitik,“ bei der kulturelle Bildung „als integraler Bestandteil des regulären Schulsystems verankert und gestärkt wird. Begegnungsmöglichkeiten mit Kunst und Kultur sind nicht auf außerschulische Kulturvermittlungsaktivitäten zu reduzieren“.
Die EU-Kulturförderprogramme müssen die "Förderung von Kunst und Kultur und nicht Förderung des wirtschaftlichen Mehrwert von Kunst und Kultur (Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Innovation) in den Mittelpunkt stellen." Dazu zählt auch der "Abbau von Zugangsbarrieren zu den EU-Förderprogrammen für kleine Kulturorganisationen."
Weiterführende Information:
https://www.unesco.at/querschnittsthemen/article/klausurtagung-kulturelle-vielfalt/