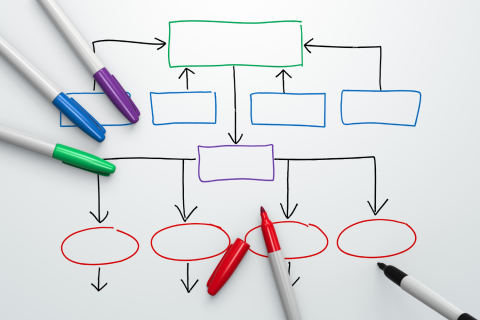Von kurzfristigen Rettungsleinen zu soliden Sicherungssystemen
Mit unerbittlicher Schärfe hat uns die derzeitige Pandemie die Vulnerabilität der täglichen Arbeitswelt von Kunst- und Kulturschaffenden vor Augen geführt. Die Krise ist ein Weckruf an die Politik, nachhaltige Änderungen herbeizuführen: Weg von kurzfristigen Rettungsleinen, hin zu soliden, krisenfesteren Sicherungssystemen, die in Partner*innenschaft mit dem Kunst- und Kultursektor erarbeitet werden. In einem gemeinsamen Kommuniqué skizzieren Interessenvertretungen des Kunst- und Kulturbereichs Wege aus der Krise.

Auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission haben sich Interessenvertretungen des Kunst- und Kulturbereichs Ende Oktober zusammengefunden, um gemeinsam den Status Quo zu analysieren und Handlungsperspektiven für einen wirksamen Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen über die Krise hinaus zu entwickeln. Als Richtschnur der Diskussionen diente die UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen - jener völkerrechtlicher Vertrag, der internationale Standards der Kulturpolitik definiert und von Österreich vor 13 Jahren ratifiziert wurde. Herzstück der Konvention ist die Sicherung eines Umfeldes, in dem sich eine Vielfalt an zeitgenössischem Kunst- und Kulturschaffen frei entfalten kann und vor einer rein ökonomischen Betrachtungsweise geschützt ist.
Die Ergebnisse der Analysen und Diskussionen wurden in einem Kommuniqué veröffentlicht. Anhand ausgewählter Themenschwerpunkte zeigen wir Handlungsnotwendigkeiten für Bund, Länder und Gemeinden auf, die für einen wirksamen Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen über die Krise hinaus erforderlich sind.
Die Krise muss ein Weckruf für die Politik sein, nachhaltige Änderungen herbeizuführen – sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Art und Weise, wie Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden sollen. Es braucht ein Umdenken: Weg von kurzfristigen Rettungsleinen, hin zu soliden, krisenfesteren Sicherungssystemen, die in Partner*innenschaft mit dem Kunst- und Kultursektor erarbeitet werden. Eine Trendwende in diese Richtung könnte der angekündigte Fairness Prozess sein, der sich der beschämend niedrigen Entlohnung professioneller Arbeit in Kunst und Kultur widmen soll. Es gilt jetzt Vorsorge zu treffen, damit der Sektor nach der Krise nicht unwiederbringlich zusammenbricht.
Zentrale Forderungen des Schlusskommuniqués sind:
- Angemessene Bezahlung und faire Vertragsverhältnisse als Grundbedingung für soziale und ökonomische Stabilität – gerade in Krisenzeiten
- Schaffung eines ausgewogenen Urheber:innenvertragsrecht, das die Interessen der Künstler:innen als Teil der Bemühungen um Fair Pay berücksichtigt
- Forcierung partizipativer Politikgestaltung, sowohl auf Länder- als auch Bundesebene für das unmittelbare Krisenmanagement als auch bei der Entwicklung dringend notwendiger mittel- und langfristiger Kulturstrategien
- Umsetzung von Maßnahmen, die eine weitere/verschärfte strukturelle und existenzgefährdende Benachteiligung von Kunstschaffenden aus sog. Drittstaaten zu vermeiden