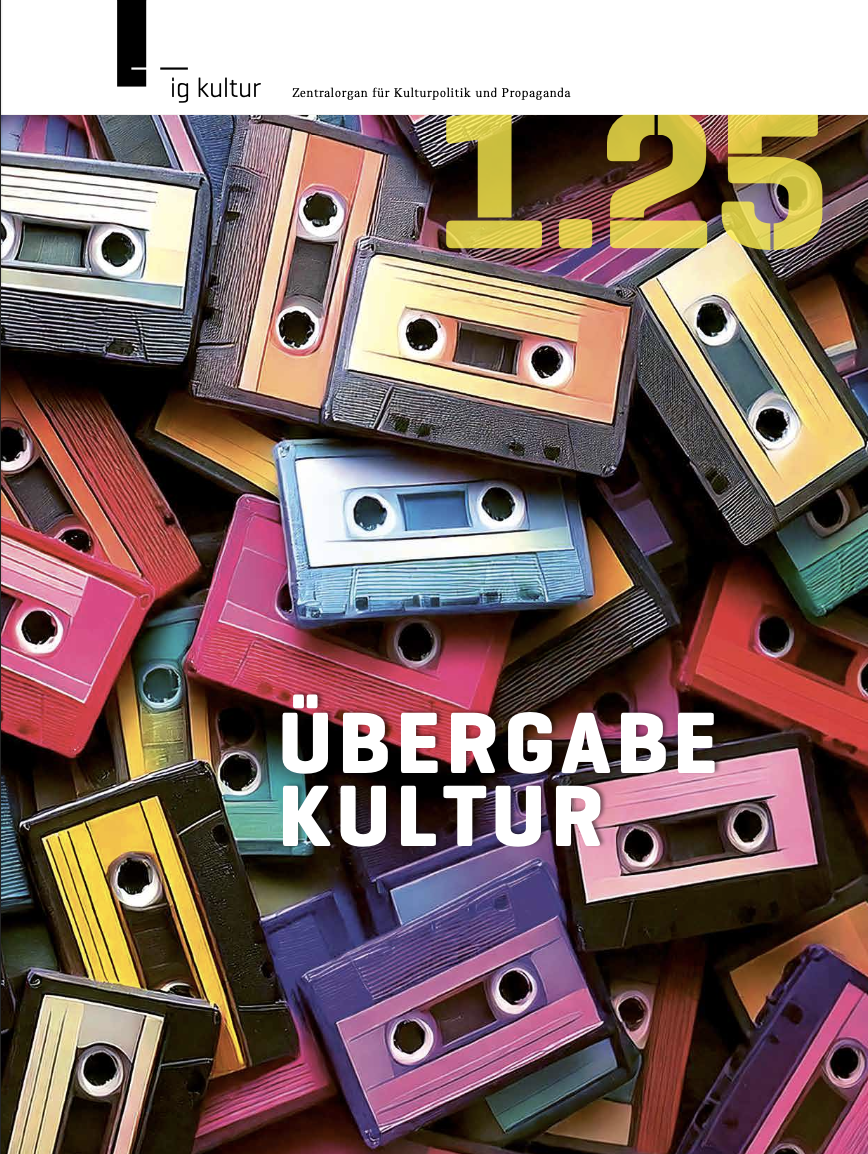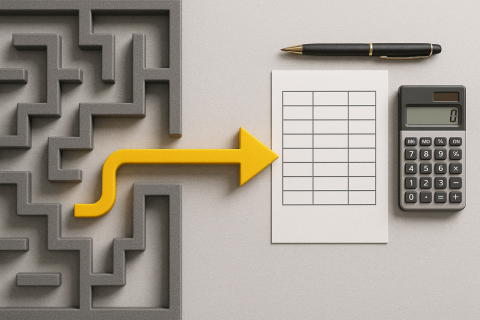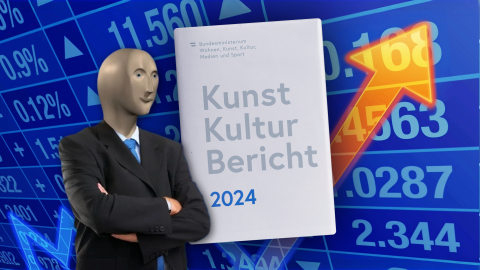Helene Schnitzer– Du hast dich im Laufe deines Berufslebens viele Jahre mit den Lebenswelten von jungen Menschen auseinandergesetzt. Passen die Lebensrealität von Jugendlichen und ein Engagement in einem Verein heute überhaupt noch zusammen?
Lukas Trentini– Da sich die Gesellschaft stetig weiterentwickelt, ändern sich auch die Formen von Engagement. Dass man sehr verbindlich über einen langen Zeitraum in einem Verein tätig ist, wie das die Elterngeneration heutiger Jugendlicher vielleicht noch gekannt hat, ist in der Form bei Jugendlichen kaum mehr zu beobachten. Man muss aber dazusagen, dass sich junge Menschen nach wie vor engagieren wollen, aber ihr Engagement sieht anders aus, ist oft kürzer oder projektbezogener. Zentral für Jugendliche ist, dass die Idee stimmt und dass sie mit Menschen zusammenarbeiten, die sie mögen.
Du hast in einer Fortbildung zum Thema „Nachwuchs im Verein“ von der Bedeutung der Beziehungsqualität gesprochen, die mit ausschlaggebend dafür ist, ob sich junge Menschen von einem Verein angesprochen und eingeladen fühlen. Worauf kommt es dabei an?
Lukas Trentini– Die Beziehungsebene ist aus meiner Sicht wirklich sehr entscheidend, ob sich junge Menschen angesprochen und ernst genommen fühlen. Oft geht es um kleine Schritte wie Interesse bekunden oder sprichwörtlich auf Augenhöhe kommunizieren. Wir Erwachsenen in Vereinen sollten reflektieren, wie wir Jugendlichen begegnen und ob wir sie als ein ernstzunehmendes Gegenüber wahrnehmen. Beziehung baut auf unterschiedlichen Säulen auf, aber ein zentraler Punkt ist wirklich ein ernsthaftes Interesse. Junge Menschen spüren sehr schnell, ob es echt oder nur aufgesetzt ist. Für einen Verein bedeutet das, in Beziehungsangebote zu investieren und Begegnungsorte zu schaffen, die für junge Leute attraktiv sind und das Kennenlernen ermöglichen.
Wir hören von Kulturinitiativen oft, dass der Nachwuchs im Verein fehlen würde. Wie und wo können Kulturvereine junge Menschen ansprechen und vielleicht für eine Mitarbeit gewinnen?
Lukas Trentini– Vereine haben die Möglichkeit, in Settings und Strukturen zu gehen, wo sich Jugendliche bereits aufhalten. Sie können sich z. B. in Schulen im näheren Umfeld des Vereins präsentieren oder eine Schulklasse mit einem konkreten Angebot besuchen. Eine andere Möglichkeit sind Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit wie Jugendzentren und Jugendtreffs. Wenn ein Verein dort ein kulturelles Angebot für Jugendliche vorstellt, sei es Musik, Theater oder Ähnliches, oder bereits vor Ort mit den Jugendlichen ins Tun kommt, kann das eine Win-win-Situation für alle Beteiligten sein. Denn wenn Erwachsene, die für etwas brennen, mit Jugendlichen zusammentreffen, die einmal etwas ausprobieren wollen, dann würde ich dem eine große Chance beimessen. Wichtig ist die Offenheit vonseiten der Erwachsenen, dass dieses erste Kennenlernen nicht sofort zu einem Engagement im Verein führen muss. Es geht darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Jugendeinrichtungen, wo Jugendliche informell ohne Anmeldung, ohne besondere Vorkenntnisse oder Voraussetzungen zusammenkommen, sind geeignete Plattformen für offene Angebote und Experimentierräume, die es Jugendlichen ermöglichen, etwas kennenzulernen und auszuprobieren. Vielleicht entsteht dann dieser zündende Funke, wo jemand sagt, das wollte ich eigentlich schon immer machen.
Gehen wir davon aus, dass wir Jugendliche begeistern können und sie Lust haben, im Verein mitzumachen. Wie kann eine echte Teilhabe gestaltet werden? Welche Möglichkeiten der Partizipation bieten sich in der Vereinsarbeit mit jungen Menschen an?
Lukas Trentini– Es gibt unterschiedliche Formen von Partizipation. Die erste Voraussetzung für Teilhabe ist Information und Transparenz über Vorgänge und Prozesse in einem Verein. Damit ich mich einbringen kann, muss ich informiert werden und verstehen können, wie so ein Verein funktioniert. In weiterer Folge geht es um Mitsprache z. B. beim Programm. Bei der Angebotsentwicklung eines Vereins ist es wünschenswert, dass Themen, Formate und Ideen von jungen Menschen mehr Platz finden.
Die nächsten Stufen der Partizipation sind Mitentscheidung und Selbstverwaltung, wobei geklärt sein muss, in welchem Rahmen dies für die Jugendlichen aber auch für den Verein machbar und sinnvoll ist. Es gibt Vereine, in denen junge Menschen in einem definierten Bereich selbst entscheiden können, was sie tun und welche Projekte sie umsetzen möchten. Aber Mitentscheidung und Selbstverwaltung brauchen auch Spielregeln.
Spannend ist, dass aus meiner Erfahrung diese Beteiligungsarbeit vor allem mit den Erwachsenen zu erfolgen hat, im Sinne von Bewusstseinsbildung, Aufklärung und Sensibilisierung. In unserer Kultur werden Jugendliche oft nicht als vollwertiges Gegenüber wahrgenommen. Gleichzeitig wird jungen Menschen in manchen Bereichen viel zugetraut, wir haben in Österreich das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, die Strafmündigkeit liegt bei 14. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass ich auch mit einer Gruppe von Vierzehnjährigen in einem Verein gut und ernsthaft arbeiten kann, auch wenn sich Jugendliche in der Pubertät oftmals in einer instabilen oder krisenhaften Phase befinden.
In vielen Vereinen steht in absehbarer Zeit ein Generationenwechsel an, der oft als schwierig erlebt wird. Gehen wir davon aus, dass es bereits junge Menschen im Verein gibt, die schon Erfahrungen sammeln konnten und bereit sind, sich mehr zu engagieren. Was sind aus deiner Sicht Faktoren des Gelingens, damit die Übergabe von Verantwortung oder der Vereinsleitung an die nächste Generation gut funktioniert?
Lukas Trentini– Aus meiner Sicht ist ein zentraler Baustein für das Gelingen von Generationenwechseln, dass das Engagement der Person oder der Gruppe, die viel Arbeit in einen Verein investiert und vielleicht Pionierarbeit geleistet hat, gesehen und gewürdigt wird. So ein Wechsel ist ein Übergang, und der muss gestaltet werden. Da geben langjährig engagierte Personen vielleicht ihr Lebenswerk, ihr Erbe in junge Hände. Wenn es den Pionier*innen gelingt, Anerkennung und Würdigung ihrer Leistung anzunehmen, dann kann die junge Generation viel besser übernehmen. Es muss diese Übergabe aktiv gestaltet werden, sonst fällt sinnbildlich etwas auf den Boden und es muss neu aufgehoben, neu begriffen und bearbeitet werden. Damit die Pionier*innen loslassen können, ist es auch hilfreich, einen klaren Zeitpunkt für die Übergabe zu definieren und die Zuständigkeiten neu zu regeln. Dafür braucht es neue Strukturen und Absprachen, wie man künftig im Verein zusammenarbeitet.
Für die Jungen kann es auch überfordernd sein, in große Fußstapfen zu treten. Man hat vielleicht die Pionier*innen vor Augen, die einen Verein aufgebaut und zur Blüte gebracht haben. Wie können die Übernehmenden mit dem Erwartungsdruck umgehen?
Lukas Trentini– Mit Sicherheit gilt es, Anforderungen und Erwartungen von den scheidenden Personen, aber auch von Vereinsmitgliedern oder sogar von außen zu benennen und darüber zu reden. Übergänge sind oft krisenhaft, das ist eine Realität. Wenn etwas groß, gut und schön war, wird es jetzt vielleicht ganz anders werden. Eine Begleitung in dieser Übergangsphase ist sicher hilfreich, eine Person, die diesen Prozess im Blick hat und immer wieder verdeutlicht, es wird nicht exakt gleich weitergehen. In dieser Phase ist der Verein nach außen hin vielleicht weniger aktiv, was nicht heißt, dass nichts passiert. Wie im Kreislauf der Natur braucht der Verein vielleicht eine gewisse Brachzeit, um sich neu zu orientieren. Nach innen gilt es nämlich, diese Zeit zu nutzen und zu schauen, was in Zukunft Neues passieren kann. Der Fokus auf das Potenzial, das die jungen, engagierten Leute einbringen, hilft, Druck herauszunehmen und Selbstvertrauen zu stärken.
Ist das ein Plädoyer für Reflexion und ausreichend Zeit für diese Übergangsphase im Verein, für das Anerkennen von Grenzen – vor allem die der eigenen Ressourcen?
Lukas Trentini– Das ist etwas grundlegend Menschliches, wir alle haben Grenzen. Wenn sich eine junge Person engagieren will, aber nur gewisse Kapazitäten frei hat, ist das eine Realität, die es anzuerkennen gilt. Engagement im Sozial- und Kulturbereich ist oft mit Selbstausbeutung verbunden. Die gute Nachricht für mich ist: Viele junge Erwachsene haben das erkannt und sind nicht mehr bereit, sich auf diese Art und Weise in einem Verein zu verausgaben. Das führt vielleicht zu Enttäuschung bei der älteren Generation, aber gleichzeitig zu neuen Formen von Engagement im Kulturverein. Dies wird der Generationenwechsel in den nächsten Jahren – je mehr er sich vollzieht – noch stärker sichtbar machen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Lukas Trentini ist Kinder- und Jugendanwalt für Tirol. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Verbandlichen und Offenen Jugendarbeit, ist Mitgründer von POJAT (Dachverband Offene Jugendarbeit Tirol) und von bOJA (bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit). Er ist Organisationsberater, Netzwerker, Moderator, Kinder- und Jugendexperte.
Helene Schnitzer ist seit 2000 Geschäftsführerin der TKI – Tiroler Kulturinitiativen mit den Schwerpunkten Kulturpolitik, Interessenvertretung, Vernetzung und Beratung von Kulturinitiativen sowie Projektentwicklung. Sie hat Kunstgeschichte in Wien und Innsbruck studiert und war mehrere Jahre als Kulturvermittlerin in Tiroler Museen und Ausstellungshäusern tätig.
Coverbild: Workshop ("Modulare Synthesizer"), eine Kooperation von Inseminoid und Freirad © Barbara Alt
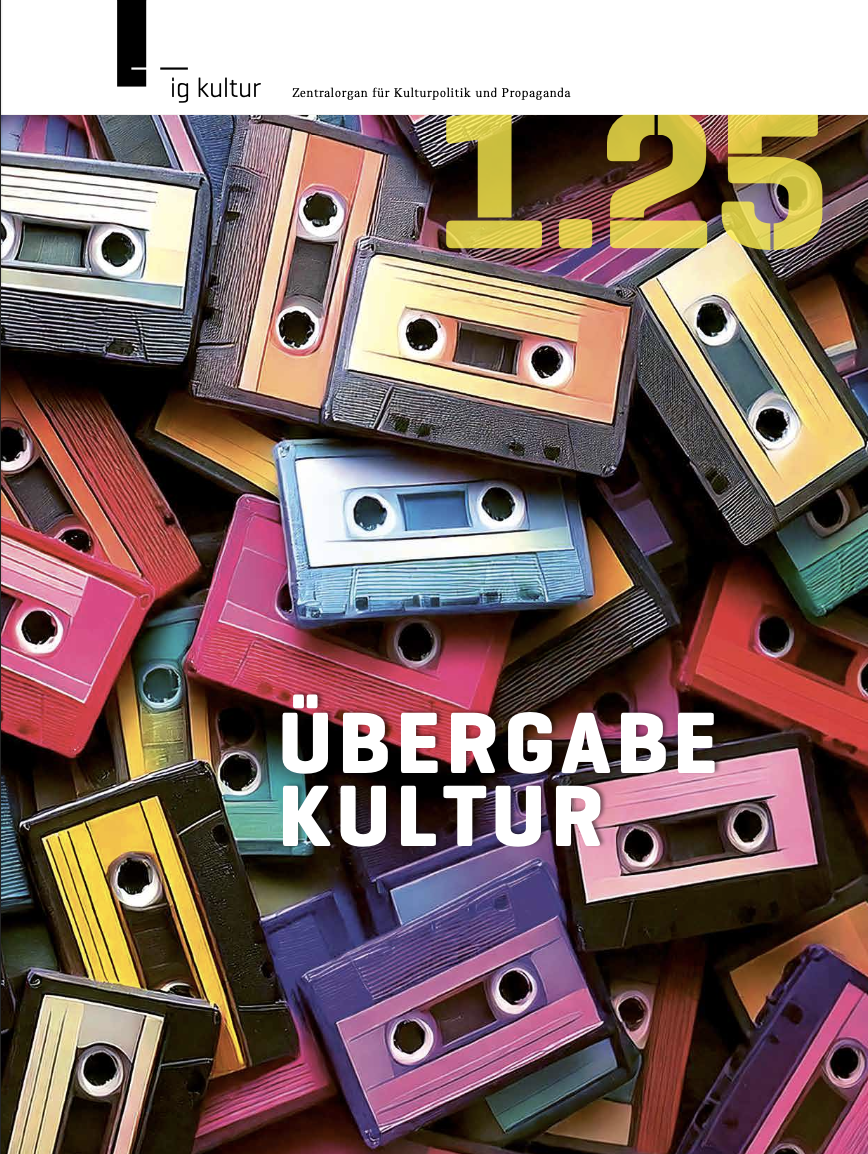
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.25 „ÜBERGABE KULTUR“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.
Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5,50 €) bestellt werden.