Ein Kollektivvertrag für die Kulturarbeit?
Gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen – und das verbindlich für alle in der freien Kulturarbeit? Die Antwort scheint einfach: Ein Kultur-Kollektivvertrag! Über mögliche Wege zu einem Kultur-Kollektivvertrag und dessen Auswirkungen auf die Finanzierungspraxis.
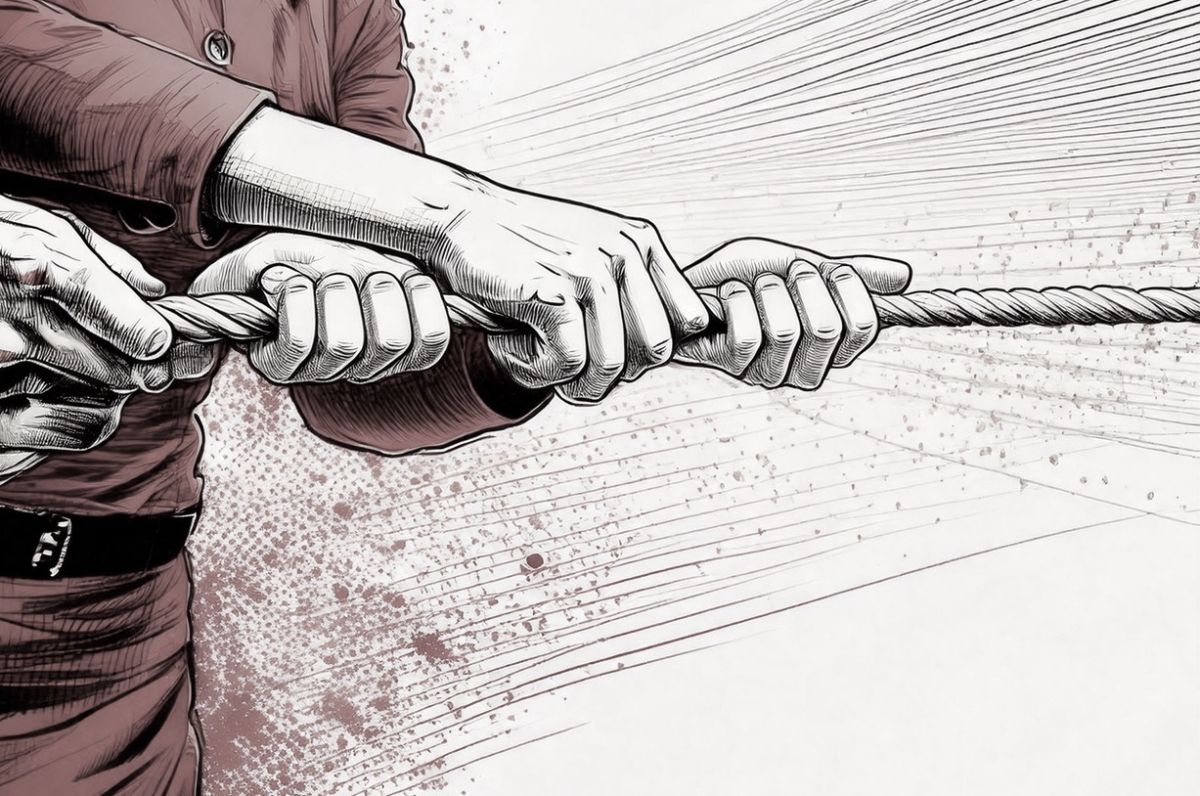
Der Beitrag erschient erstmals in der KUPFzeitung 192, 12/2024 – 02/2025
In Österreich gelten Kollektivverträge als die beste und bewährteste Lösung, um verbindliche Standards festzulegen, abgestimmt auf die Realitäten im jeweiligen Sektor. Ein allgemeiner Kultur-Kollektivvertrag existiert jedoch bislang nicht. Warum eigentlich nicht? Und noch viel entscheidender: Will das „der“ Kultursektor überhaupt?
Geltende Standards
Die aktuellen Arbeitsstandards definiert das Recht. Es setzt Grenzen, selbst wenn sich alle Beteiligten eine andere Lösung wünschen, etwa eine Tätigkeit auf Honorarbasis oder ohne Entgelt ehrenamtlich durchzuführen. Eine Prüfung durch die Gesundheitskasse oder die Finanzpolizei kann in derartigen Fällen schnell zu existenzbedrohenden Strafzahlungen für Kulturvereine führen. Auch ohne Kollektivvertrag gibt es also gewisse verbindliche Standards in der freien Kulturarbeit – nur nicht zur Entlohnung selbst.
Leerstelle Entlohnung
Zur Entlohnung schweigt der Gesetzgeber. Lediglich ein „angemessenes Entgelt“ ist vorgegeben, wie hoch ein „angemessenes Entgelt“ ist, bleibt offen. In Österreich gibt es zudem, anders als in anderen Staaten, keinen gesetzlichen Mindestlohn. Das liegt daran, dass 98% der Arbeitnehmer*innen in Österreich von Kollektivverträgen geschützt sind, die branchenspezifische Mindestlöhne und -gehälter definieren. Und die anderen 2%? Hier landen wir wieder beim Kultur-Kollektivvertrag.
Hürdenlauf zum Kollektivvertrag
Ist ein Kollektivvertrag für freie Kulturarbeit denn möglich? Theoretisch ja. In der Praxis wären einige Hürden zu nehmen. Mangels Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer bräuchte es eine kollekivvertragsfähige Vertretung der Arbeitgeber*innen – also den freiwilligen Zusammenschluss der Kulturvereine mit dem erklärten Ziel, Arbeitsbedingungen durch Kollektivverträge zu regeln. Dieser Zusammenschluss müsste so viele Mitglieder haben, dass er seine maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung im räumlich und sachlich definierten Bereich – z.B. der freien Kulturarbeit – nachweisen kann. Ob dies der Fall ist, entscheidet das Bundeseinigungsamt, welches die Kollektivvertragsfähigkeit verleihen muss. Erst dann kann mit der Gewerkschaft ein Kollektivvertrag verhandelt werden. Aber auch dieser bindet dann nur jene Kulturvereine, die Mitglied sind und bleiben – und sich damit freiwillig den Standards des Kollektivvertrags unterwerfen.
Realitäts-Check Finanzierung
Wie schwierig es ist, eine freiwillige Selbstbindung an Mindestgehälter zu schaffen, weiß jeder Kulturverein, der versucht Fair Pay umzusetzen. Gerade in der freien, nicht-kommerziellen Kulturarbeit sitzen nicht nur Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen am Verhandlungstisch, sondern zumeist auch öffentliche Förderstellen als unsichtbare Dritte. Solange Förderstellen sich nicht zur Einhaltung von Mindeststandards in ihrer Förderpraxis verpflichten, wird ein Kultur-Kollektivvertrag an der Problematik wenig ändern. Denn ein Kollektivvertrag bindet die öffentliche Finanzierung nicht.
Der springende Punkt ist und bleibt die öffentliche Hand. Jede Förderstelle kann auch ohne Kollektivvertrag bereits jetzt die Einhaltung von Fair-Pay-Mindeststandards bei Honoraren und Gehältern zur Förderbedingung machen. Dann müsste sie jedoch auch die Verantwortung für die chronische Unterfinanzierung und den drastischen Rückgang des Kulturangebots übernehmen, so sie nicht das entsprechende Budget zur Verfügung stellt. Vielfalt im Kulturangebot ist etwas wert — und kostet auch etwas.
Fazit
Bringt ein Kultur-Kollektivvertrag am Ende also gar nichts, da er an der chronischen Unterfinanzierung nichts ändert und nur jene bindet, die sich ihm freiwillig unterwerfen? Doch – zumindest perspektivisch gedacht! Denn jeder Kollektivvertrag kann “gesatzt” werden, sobald er in einem Sektor überwiegende Bedeutung hat. Dadurch wird er auch für jene bindend, die sich nicht freiwillig dazu verpflichten. Dass das funktionieren kann, zeigen die Sozialwirtschaft und die private Erwachsenenbildung. Sie definieren österreichweit Standards in ihren Sektoren. Für diese Vision braucht es aber den gemeinsamen Willen aller Beteiligten – von Kulturarbeiter*innen, Kulturvereinen, Gewerkschaften bis hin zu Kulturpolitik und den Förderstellen der öffentlichen Hand.



