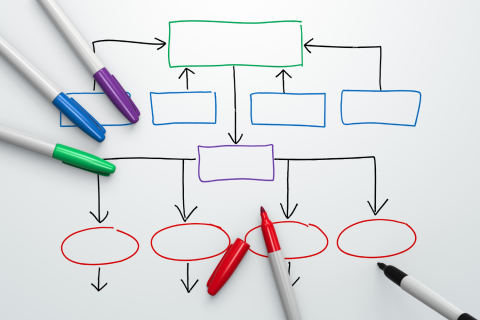Doch Pipifax? Das rot-grüne Kulturprogramm in Wien
Konnten sich die Grünen der sozialdemokratischen Übermacht nicht erwehren, oder steckt dahinter ein kulturpolitisches Desinteresse der Grünen?
Die rot-grüne Wiener Stadtregierung ist an sich ja mal keine schlechte Nachricht. Und die kulturpolitischen Vorhaben, die im Koalitionsabkommen formuliert sind, geben Anlass zur Hoffnung, dass ein politischer Gestaltungswille wieder entdeckt wurde. Zumindest ein bisschen. Die positive action-Maßnahmen zugunsten von Migrant_innen sind ein positives Signal. Wobei die Umsetzung noch spannend wird, v. a. wenn es um personenbezogene Förderung geht, da die Definition von Migrant_innen den politischen Willen verdeutlichen wird. Aber nichtsdestotrotz, das Thema „Interkulturalität und Migrant Mainstreaming“ stellt eindeutig den inhaltlichen Höhepunkt des Kulturprogramms dar.
Ansonsten allerdings wenig Neues – was vielleicht nicht erstaunt. Dass die SPÖ versucht, in Verhandlungen das Maximum herauszuholen, ist klar. Dass dieses kulturpolitische Maximum ein uninspiriertes Fortschreiben einer konservativ an bürgerlicher Hochkultur orientierten Fördervergabe ist, zählt zu den bedauerlichen Umständen hiesiger Kulturpolitik. Die aktuelle Studie „Kultur und Geld“ der IG Kultur Wien hat deutlich gezeigt, dass trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse der Großteil der öffentlichen Mittel in den Bereich der darstellenden Kunst fließt, während sich in der freien Szene die Arbeitsbedingungen rapide verschlechtern. Zwar ist es nunmehr der Wiener Kulturpolitik ein Anliegen, die Präsenz von Kulturinitiativen zu stärken – aber das sagt eigentlich nicht viel.
Wie sich insgesamt wenig Konkretes im Kulturprogramm findet – und was sich finden lässt, gibt nicht zu großen Hoffnungen Anlass. Ein neues Wien Museum steht im Programm – so weit, so gut. Und die Creative Industries werden genannt, denn sie sind „für die kulturelle Produktion in Österreich von besonderer Bedeutung“. Das soll hier nicht bezweifelt werden und ist auch nicht gerade neu. Nur warum sollen „junge Talente im Bereich der digitalen Innovation“ gerade aus dem Kulturbudget gefördert werden?
Der Rest lässt den Verdacht aufkeimen, die SPÖ hätte ihre Vorhaben per copy-and-paste eingefügt. Dies wird besonders deutlich, wenn sich die Kulturpolitik „unter Beteiligung aller“ „immer neu erfinden“ muss und dafür wieder die weitgehend unbekannte Initiative „Wien denkt weiter“ strapaziert wird. Bekanntlich handelt es sich dabei um eine Agenturerfindung, mit der versucht wird, social media für Parteiwerbung einzusetzen. Das bisherige Highlight dieser Initiative war ein Symposium, das im Wahlkampf veranstaltet wurde – und zu dem keine einzige Person mit Migrationshintergrund eingeladen war. Zumindest nicht zum Sprechen, zum Klatschen vielleicht schon. Die heftige Kritik an diesem Vorgehen wurde nicht einmal ignoriert. Etwas gewagt daher, diese Initiative gleich anschließend an Migrant Mainstreaming an prominenter Stelle im Kulturprogramm zu platzieren.
Konnten sich die Grünen der sozialdemokratischen Übermacht nicht erwehren, oder steckt dahinter ein kulturpolitisches Desinteresse der Grünen? Das soll jetzt natürlich nicht unterstellt wären, gab es doch immer engagierte Proponent_innen einer kritischen Kulturpolitik. Doch während der Koalitionsverhandlungen wirkten die grünen Kulturagenden ein wenig verwaist, bis Marie Ringler kurzfristig wieder hereingeholt wurde. Ein demokratiepolitisch eher schwachbrüstiges Vorgehen, dessen Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinter den Forderungen zurücksteht.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das rot-grüne Projekt in der Kulturpolitik enttäuschend begonnen hat. Vielleicht wird das ja in der konkreten Politik noch deutlicher – oder sollten auch die Grünen Kultur als Pipifaxressort verstehen?