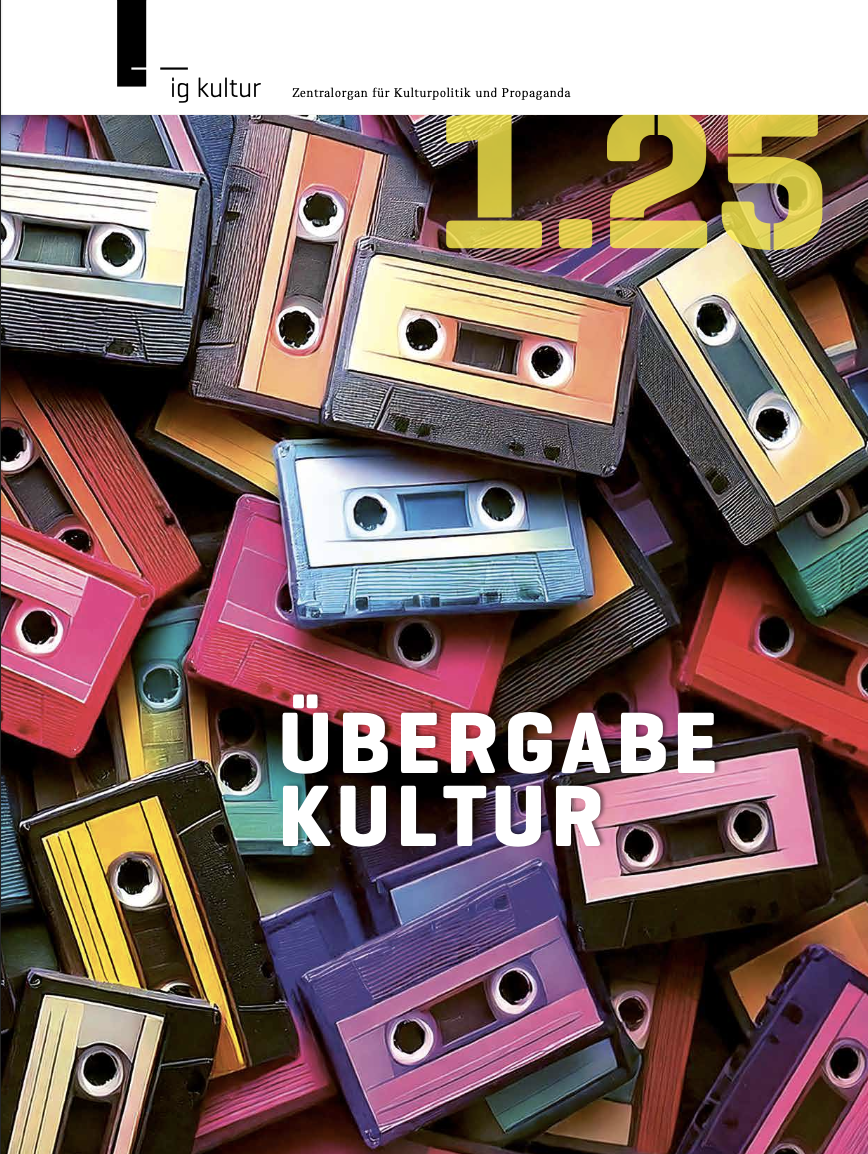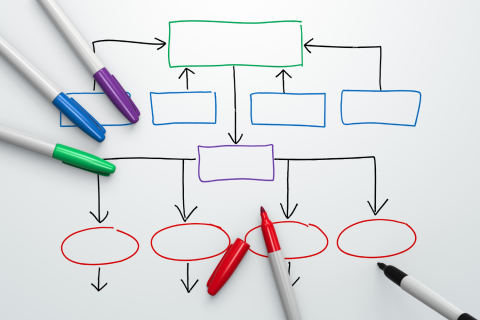Die Sozialisationsorte von Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert und sind im Kontext einer sich wandelnden Gesellschaft von hohen Individualisierungsanforderungen geprägt. Die Beeinflussung durch kommerzielle Konsumwelten, digitale Formate und neue „jugendkulturelle“ Ausdrucksformen und Trends in Peergroups hat gegenüber traditionellen Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Religionsgemeinschaften, Museen, Vereinen oder Parteien an Bedeutung gewonnen. Klassische Jugendkulturen und Jugendszenen sind heute keine starren Konstrukte mehr, sondern werden als Supermarkt der Identitäten genutzt, ergänzt und umgedeutet. Dabei bieten „jugendkulturelle“ Ausdrucksformen nicht nur soziale, kulturelle, sportliche und ästhetische Lernfelder, sondern dienen als Lebenswelt, in der Jugendliche Handlungskompetenzen, Geschlechteridentitäten, Werte und Kreativität entwickeln und erlernen können. Diese vorhandenen Bildungspotenziale sichtbar zu machen und (sozio-)kulturelle Bildungsformate für Jugendliche in den unterschiedlichen Institutionen breit zu implementieren, ist eine Notwendigkeit, die gesellschaftliche Entwicklungen unterstützt, Begegnungsräume schafft und Jugendliche in die unterschiedlichen Institutionen und Funktionen einbinden kann. Dazu bedarf es einer grundlegenden Offenheit der Verantwortlichen gegenüber den Bedürfnissen junger Menschen, die alle institutionellen Ebenen und Akteur*innen mit einbezieht.
Damit (sozio-)kulturelle Bildung im Kulturbereich und in der Offenen Jugendarbeit gelingen kann, braucht es eine Öffnung der Institutionen, eine Anpassung der Rahmenbedingungen, ein Umdenken in den Förderbedingungen zugunsten starker, kreativer und vielfältiger non-formaler und informeller Bildungsorte und ihrer Angebote.
Der Kulturbereich ist wie die Offene Jugendarbeit einer dieser Akteur*innen, der seinen Stellenwert als Ort kultureller Jugendbildung neu und zeitgemäß entwickeln muss. Selbstverwaltete „autonome“ Jugend- und Kulturzentren gehören eher der Vergangenheit an, die Jugendzentrumsbewegung der 70er-Jahre ist vorbei, Professionalisierung und Institutionalisierung sind an ihre Stelle getreten. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig den Verlust kreativer Orte und dass Experimentier- und Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Die aktuelle Situation erfordert jedoch eine Neuorientierung und die Schaffung von demokratischen und kreativen Milieus für Jugendliche in den verschiedenen Institutionen des Jugend- und Kulturbereichs. Dabei spielen Kooperationen zwischen dem Kulturbereich und der Offenen Jugendarbeit eine wichtige Rolle.

Offene Jugendarbeit und (sozio-)kulturelle Bildung
Offene Jugendarbeit ist ein (sozial-)pädagogisches Handlungsfeld im Bereich der professionellen Sozialen Arbeit mit sozialräumlichem Bezug und sozialpolitischem, pädagogischem und soziokulturellem Auftrag. Offene Jugendarbeit begleitet und fördert junge Menschen auf ihrem Weg zu Selbstständigkeit und Mündigkeit und bindet sie in gesellschaftliche Gestaltungs- und Aneignungsprozesse ein. Der niedrigschwellige Zugang und die Freiwilligkeit der Teilnahme an ihren Angeboten fördern den Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind. So haben sich im Laufe der Entwicklung der Offenen Jugendarbeit vielfältige Arbeitsweisen, institutionelle Formen, konzeptionelle Rahmungen und methodische Handlungsansätze herausgebildet. Das Bundesjugendförderungsgesetz nennt als Ziele der Offenen Jugendarbeit geeignete Maßnahmen der Jugenderziehung und Jugendbildung, die die Erziehung und Bildung in Familie, Schule und anderen Lebensbereichen junger Menschen ergänzen, um die Entwicklung von Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement zu fördern. Dies wird in den Konzepten der Offenen Jugendarbeit immer wieder auch als Aufforderung zu unterschiedlichen „Bildungsaufträgen“ wie z.B. politische Bildung, Menschenrechtsbildung, Demokratiebildung verstanden, muss aber auch verstärkt den Bereich der (sozio-)kulturellen Bildung einbeziehen.
Bildung wird dabei im Sinne Humboldts als selbsttätiger Aneignungsprozess des Subjekts in seinen Sozialitäten verstanden, der vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Bedingungen und Lebenslagen einzelner Gruppen unterschiedlich ermöglicht oder auch behindert wird. Kennzeichnend für diese Konzepte ist eine emanzipatorische Grundorientierung, die auf die Ermöglichung zunehmender Selbstbestimmung im Rahmen einer demokratischen Mitgestaltung der Gesellschaft abzielt und dabei den schmalen Grat zwischen inhaltlicher Vorgabe und Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen beschreiten muss. Offene Jugendarbeit benötigt dabei die Unterstützung von Expert*innen und Partner*innen aus dem Bereich Kunst und Kultur, um Jugendliche mit geeigneten Formaten der (sozio-)kulturellen Bildung begleiten und aktivieren zu können.
Die möglichen Zugänge zu (sozio-)kultureller Bildung über Kooperationen mit dem Kulturbereich und der Offenen Jugendarbeit stellen sich dabei äußerst vielfältig dar, sie sind insbesondere abhängig von den spezifischen (sozio-)kulturellen Handlungsweisen und Orientierungen der teilnehmenden Jugendlichen, also z.B. von den Jugendszenen, die ein Jugendzentrum vor Ort besuchen oder von den spezifischen soziokulturellen Milieus, die eine Gruppe von Jugendlichen dominieren. Werden die kulturellen Präferenzen und Ausdrucksweisen der jeweiligen Teilnehmenden nicht ausreichend berücksichtigt, besteht schnell die Gefahr, dass sich diese abwenden. Dies gilt es bei Kooperationen und gemeinsamen Projekten mit dem Kunst- und Kulturbereich zu berücksichtigen.
Ausgehend von dieser grundsätzlichen Orientierung an den spezifischen kulturellen Interessen und Handlungsformen der beteiligten Jugendlichen entfaltet sich in der Praxis ein breites Spektrum (sozio-)kultureller Bildungsmöglichkeiten. Dazu gehören Animations- und Unterhaltungsangebote eines eher passiven Konsums insbesondere von Musik, Film, Literatur und anderen audiovisuellen Formaten; die alltägliche informelle Praxis kultureller Formate; kursförmige Angebote zum Erlernen kultureller Ausdrucksformen und Techniken (Musikinstrumente spielen, Theatertechniken einüben, Fotografie und Videografie lernen, literarische Werke verfassen, Malen und Gestalten); projektorientierte Formen der Produktion eigener kultureller Werke und Positionen (z.B. Fotostories, Videofilme, Bilder, Skulpturen, Theaterstücke, Musikproduktionen, Tanzperformances, Graffiti, Fanzines, digitale und analoge Produktionen u.v.m.). Dabei begleiten und beteiligen sich Künstler*innen und/oder weitere Personen und Fachkräfte an diesen Formaten und die Arbeitsweisen sind durch unterschiedliche Grade der Vorgabe bzw. Eigenständigkeit der beteiligten Jugendlichen als Produzent*innen und/oder Konsument*innen gekennzeichnet. Ergänzend bedarf es einer institutionenübergreifenden Kulturvermittlung, um Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten anderer (sozio-)kultureller Institutionen kennen zu lernen, Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten bereitzustellen und die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu fördern. Nicht nur das Ziel der Förderung von Selbstbestimmung, sondern auch das der gesellschaftlichen Mitverantwortung kann über die Möglichkeiten der (sozial-, kultur-)pädagogischen Begleitung solcher (sozio-)kultureller Bildungsprozesse in hervorragender Weise angegangen werden.
Kunst und Kultur für junge Menschen sichtbar und erfahrbar machen
(Sozio-)kulturelle Bildungsformate müssen für junge Menschen sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Die unterschiedlichen Formate der verschiedenen Kunstgattungen, die sich auf das Ausdrucksmedium beziehen – wie Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Literatur – müssen durch eine breite Positionierung über Personen und Institutionen für Jugendliche niederschwellig sichtbar und erlebbar gemacht werden. Eine breite Sensibilisierung für die unterschiedlichen Lebenswelten von Jugendlichen ist bei den Personen, die Jugendliche in der Kunst- und Kulturvermittlung begleiten, unerlässlich. Unterschiedliche Formate und Methoden sind bei der Aktivierung, Vermittlung und Einbindung von Jugendlichen notwendig und zu berücksichtigen. Exemplarisch seien hier genannt:
- Workshops, Proben, Kurse und Experimentieren in den verschiedenen Kultursparten bieten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten und sich in ihren Interessensgebieten weiterzubilden. Diese Angebote fördern das Interesse, die individuelle Entwicklung und das kulturelle Engagement junger Menschen und schaffen Verbindlichkeit.
- Die Teilnahme und Mitwirkung an kulturellen Projekten, Produktionen und Positionen wie Theateraufführungen, Ausstellungen, Musikveranstaltungen oder Filmproduktionen ermöglicht es jungen Menschen, verschiedene künstlerische Ausdrucksformen kennen zu lernen, ihre Talente einzubringen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Hierdurch entsteht ein kreativer Austausch mit anderen Jugendlichen und den kulturellen Akteur*innen von Institutionen.
- Die Unterstützung kultureller Ausdrucksformen, Aktivitäten und Projekte durch eigene Budgets, Räumlichkeiten und/oder andere Infrastruktur trägt dazu bei, die Entfaltung des kreativen Potenzials der Jugendlichen zu fördern. Fachkräfte unterstützen die Jugendlichen in ihren Ideen und begleiten sie.
- Die Beratung und Begleitung junger Menschen durch kulturpädagogisch geschulte Fachkräfte ist ein wichtiger Bestandteil (sozio-)kultureller Bildung. Diese Unterstützung hilft jungen Menschen, ihre kulturellen Interessen und Ziele zu definieren und ermutigt sie, an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen oder diese aktiv mitzugestalten.
- Die Vernetzung mit anderen Institutionen, Organisationen und Akteur*innen im Bereich Kultur, Bildung und Jugendarbeit fördert den Austausch von Ideen und Ressourcen und ermöglicht die Entwicklung innovativer Projekte. Jugendliche werden so in ein vielfältiges Netzwerk kultureller Angebote eingebunden und finden Möglichkeiten, sich aktiv daran zu beteiligen.
- Bewusstseinsbildung und kritische Auseinandersetzung mit kulturellen Themen wie kulturelle Identität, kulturelle Vielfalt oder gesellschaftliche Herausforderungen und deren Übersetzung sind wichtige Aspekte der (sozio-)kulturellen Bildung. Dies fördert die kulturelle Kompetenz und die Fähigkeit junger Menschen, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu beurteilen und sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einzubringen.
- Schaffung kreativer Milieus durch Netzwerke von Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die ein gemeinsames Interesse an Kunst, Kultur und Kreativität verbindet. In diesen Milieus entstehen vielfältige kulturelle Aktivitäten, Austausch und Kooperationen, die die Entwicklung neuer künstlerischer Ausdrucksformen fördern. Offene Jugendarbeit und Kultureinrichtungen sind dafür ideale Orte der Milieubildung.
- (Sozio-)Kulturelle Bildung mit Spaß und Freude. Spaß und Freude am gemeinsamen Tun stehen im Vordergrund der Bildungsformate und Aktivitäten. Gemeinschaft, Selbstwirksamkeit, Kreativität und das spielerische Ausprobieren von Formaten und Positionen stehen im Vordergrund – und natürlich ist auch Scheitern erlaubt!
Zwischenfazit und Ausblick
(Sozio-)Kulturelle Bildung im Kulturbereich und in der Offenen Jugendarbeit schafft in einem lebensweltorientierten Setting Zugänge zu Kunst und Kultur und ihren Institutionen und bietet Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten besser kennen zu lernen, Handlungskompetenzen zu entwickeln und Entwicklungsaufgaben im Jugendalter positiver zu bewältigen. Jugendliche gewinnen neue Perspektiven für die Auseinandersetzung mit unseren vielfältigen Lebenswelten und werden befähigt, Gesellschaft kreativ und kritisch mitzugestalten. Aufgabe der Kulturarbeit und der Offenen Jugendarbeit ist es, Jugendliche dabei mit unterschiedlichen Methoden, Verfahren und Angeboten zu unterstützen und zu begleiten und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Der Schlüssel zur Umsetzbarkeit ist die Freiwilligkeit der Angebote, die nur durch persönliche Anreize aus dem Kulturbereich und der Offenen Jugendarbeit in einem lebensweltorientierten Umfeld realisierbar ist.

Damit (sozio-)kulturelle Bildung im Kulturbereich und in der Offenen Jugendarbeit gelingen kann, braucht es eine Öffnung der Institutionen, eine Anpassung der Rahmenbedingungen, ein Umdenken in den Förderbedingungen zugunsten starker, kreativer und vielfältiger non-formaler und informeller Bildungsorte und ihrer Angebote. (Sozio-)Kulturelle Bildung hat das Potenzial, bestehende gesellschaftliche Fragen und Verhältnisse über die Lebenswelten junger Menschen zu bearbeiten, die immer auch Ausdruck eines herrschenden Systems von Individuum und Gesellschaft sind. Die methodischen Konzepte, Verfahren und Angebote knüpfen dabei an eine Vielzahl weiterer aktueller Themen unserer Zeit an, die sich mit Ökonomie, Ökologie, sozialer Nachhaltigkeit, kultureller Vielfalt, demographischer Entwicklung, Krieg und Frieden und der Verteilung von Ressourcen beschäftigen. (Sozio-)Kulturelle Bildung bezieht ihren gesellschaftlichen Mehrwert aus ihrem Anspruch, ein tolerantes gesellschaftliches Miteinander zu fördern, soziale und gesellschaftliche Unterschiede abzubauen und für Inklusion und Integration zu sorgen. Jungen Menschen Raum und Möglichkeiten zu geben, sich in den verschiedenen Bereichen und Institutionen der Kunst und Kultur aktiv einzubringen und dabei Bildung zu erfahren, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft mitzugestalten, ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit, die den Dialog der Generationen und Kooperationen im Jugend- und Kulturbereich voraussetzt.
www.dv-jugend.at
www.museum-joanneum.at/kioer
Florian Arlt, Akad. Sozial- und Kulturpädagoge, Dipl. Mediator; 1998–2006 Leitung des Jugend- und Kulturzentrums HOUSE in Mureck in der Steiermark, seit 2006 Geschäftsführer des Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit, seit 2009 Vorstandsmitglied des bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit – bOJA.
Fotos: Projektbilder Kunst im öffentlichen Raum Steiermark @ KiöR Steiermark / © UMJ JJ Kucek
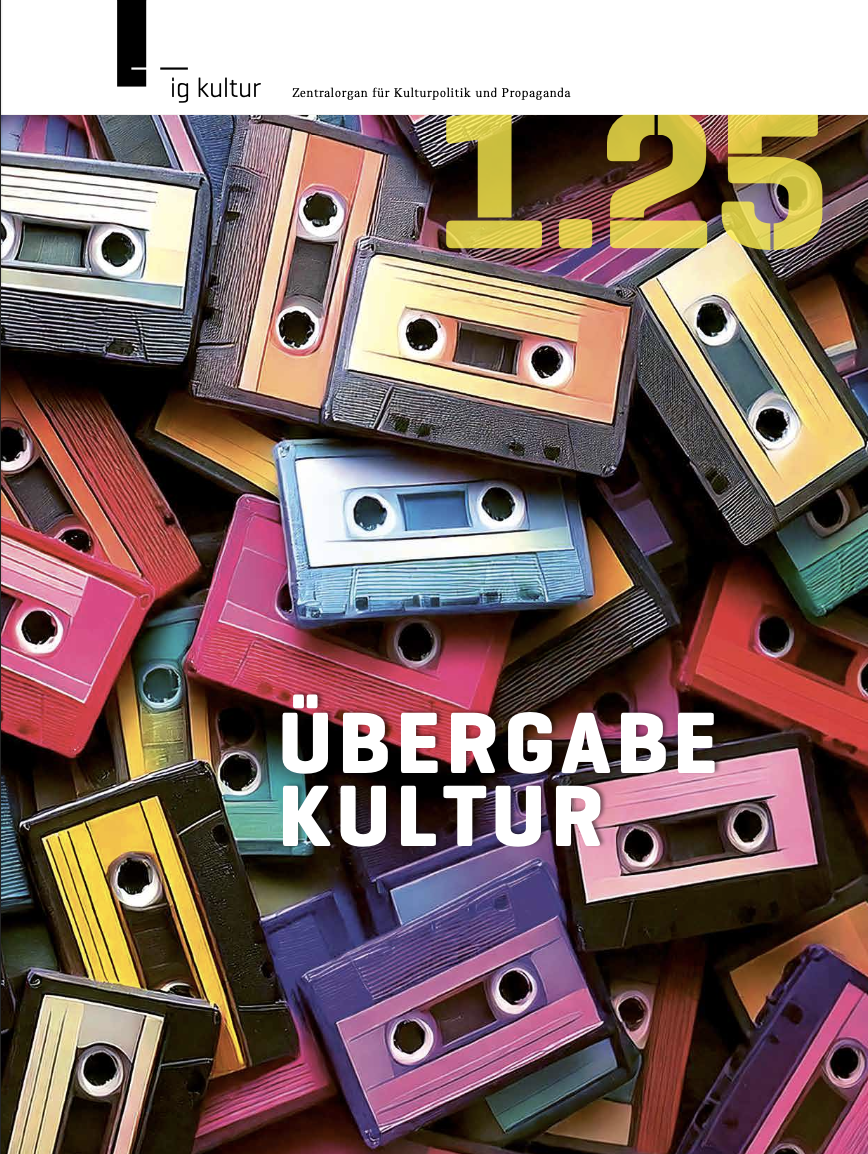
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.25 „ÜBERGABE KULTUR“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.
Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5,50 €) bestellt werden.