Immer noch „Die Anderen“
Ali Özbaş, langjähriger Geschäftsführer des Vereins JUKUS, teilt mit uns einige Gedanken zur Rolle und Anerkennung von Migrant:innen im hiesigen Kunst- und Kulturbetrieb. Er beschreibt, warum es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe braucht und wie wir dieser näher kommen können.
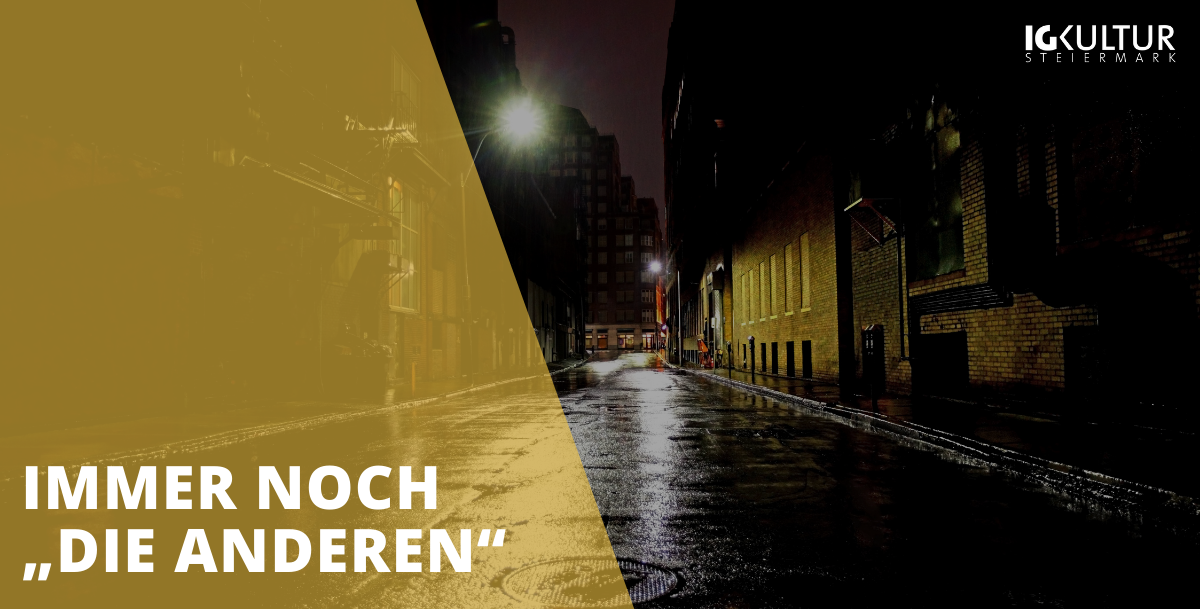
Kunst und Kultur scheinen von außen betrachtet sehr international zu sein. Im Hintergrund zeigt sich häufig, dass diese Internationalität auf bestimmte Formen von Repräsentation beschränkt, "zur Schau gestellt" und strukturell wenig verankert ist. Es macht für Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen einen riesigen Unterschied, woher sie kommen – hier spielt vor allem auch Klasse eine sehr große Rolle. Dies ist individuell und in der eigenen Community spürbar, aber auch strukturell in den etablierten Institutionen vorhanden.
Im Folgenden möchte ich einige Beobachtungen aus der Kulturarbeit teilen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wie das Projekt „re_stArt“ im Kulturjahr 2020 in Graz[1]. Für Menschen, die sich entschieden haben, einer Tätigkeit im Kunst- oder Kulturbereich nachzugehen, ist es ganz allgemein schwierig, soziale und nicht zuletzt finanzielle Anerkennung zu erlangen. Ein sozio-ökonomischer Background, der Migration miteinschließt, verstärkt diesen Aspekt allerdings dermaßen stark, dass dieses Phänomen gesondert betrachtet werden muss.
In der Steiermark bzw. in Graz lebende Migrant:innen haben unterschiedliche Migrationserfahrungen (Gastarbeit, Familienzusammenführung, Flucht oder Studium) sowie sozioökonomische Hintergründe und bringen daher ebenso vielfältige Lebenserfahrungen mit sich. Mit Bourdieu gesprochen bringen sie daher auch immer unterschiedliche Kapitale[2] mit sich. Es macht bezüglich der Chance auf soziale und kulturelle Teilhabe, beruflichen Erfolg oder gar sozioökonomischen Aufstieg einen Unterschied, ob jemand zum Beispiel als Gastarbeiter:in nach Graz kam oder als Student:in. Schon allein dadurch, dass Gastarbeiter:innen nur „zum Arbeiten bestellt“ (zeitlich befristet, in Randbezirken, schwere Arbeit, Sprachbarriere etc.) und nie in Kulturprozesse inkludiert wurden, ist die Ausgangsposition für diese Gruppe anders als für Student:innen, die strukturell mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglicht bekommen (Sprache, Bildung, räumliche Nähe zu Kunst und Kultur etc.). Und genau diese unterschiedlichen Ausgangslagen innerhalb migrantischer Communitys sind verschränkt mit und werden verstärkt durch gesellschaftliche Hierarchisierungen und Diskriminierungen wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Bildungsbenachteiligung usw.
Kannst du nichts herzeigen, bist du nichts!
Wer aus einer migrantischen Community kommt und eine künstlerische Laufbahn einschlägt, ist häufig auch mit Misstrauen vonseiten des eigenen Umfelds konfrontiert. Mit Ausnahme traditioneller Kunstformen wie Folklore und Unterhaltungskunst, wie etwa Performances auf Hochzeiten, kann häufig ein hoher (finanzieller) Erwartungsdruck beobachtet werden. Wer neben der künstlerischen Tätigkeit aus finanziellen Gründen auch noch einer „normalen“ Arbeit nachgehen muss, wird gar nicht erst als Künstler:in wahrgenommen. Wer in der Community als Künstler:in anerkannt werden will, müsste ökonomisch dermaßen erfolgreich sein, dass durch den finanziellen Erfolg auch die soziale Anerkennung, also das symbolische Kapital innerhalb der Community steigt. Eine andere Möglichkeit, Anerkennung zu erlangen, besteht darin, in einer wirklich breiten Öffentlichkeit sichtbar zu sein, zum Beispiel durch Medienberichte mit großer Reichweite. Nicht umsonst wählen viele migrantische Studierende Studienrichtungen mit höheren Verdienst- und Statuschancen. Denn als Arzt bzw. Ärztin oder Anwalt bzw. Anwältin wird dir von deiner Community ohne große Erklärung ein hoher sozialer Status zuerkannt.
Ebenso distanzieren sich aber auch Personen, die eine künstlerisch-kulturelle Laufbahn einschlagen, häufig von ihren Communitys, da eine Verständigung über Kunst und Kultur oft nicht gut möglich ist. Gesamtgesellschaftlich ist der Stellenwert von Künstler:innen ein anderer als jener von Arbeiter:innen, daher ist (vielleicht bildungsbürgerlich geprägt) ein anderes Zugehörigkeitsgefühl vorhanden.
Künstler:innen, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben, in städtische Kunstszenen involviert sind und sich im öffentlichen Raum (Museen, Festivals etc.) präsentieren, haben eine Anerkennung seitens der Institutionen geschafft. In ihrem eigenen soziokulturellen Umfeld sind sie oft weniger stark verankert, denn in ihren Communitys und Familien erfahren Künstler:innen teilweise wenig Anerkennung. Sie fühlen sich mitunter nicht ernst genommen; es gibt das Vorurteil, dass sie (zu) viel verdienen oder wenig Respekt, weil sie zu wenig verdienen; es kann Distanzierung statt Zusammenarbeit beobachtet werden etc.
Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass ich hier nur von beobachteten Tendenzen spreche. Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass einige Familien oder Communities sehr stolz auf die künstlerische Tätigkeit ihrer Angehörigen sind. Dies freut mich umso mehr. Ich sehe dies beispielswiese, wenn ich von Eltern immer wieder zu den Veranstaltungen ihrer Kinder eingeladen werden.
Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, bei dem auch die Kunst- und Kulturszene ihren Beitrag dazu leisten müsste, in der Steiermark lebende Migrant:innen, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind oder sein möchten, auch als Künstler:innen wahrzunehmen bzw. ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Diese Wahrnehmung sollte in unterschiedlichsten Kontexten passieren, vor allem aber durch Beteiligung. Sie sollten in unterschiedliche Prozesse eingebunden werden, damit dies auch eine nachhaltige Wirkung entfalten kann – und zwar in allen Bereichen, nicht nur in denen, die Migrant:innen häufig zugewiesen werden wie beispielsweise Themen mit Bezug auf ihre Migrations- und Rassismuserfahrungen, traditionelle Kunstformen etc.
"Du kannst ja übersetzen."
Um die Ebene allgemeinerer Beobachtungen zu verlassen, möchte ich an dieser Stelle von einem persönlichen Erlebnis berichten, das mich ebenso individuell gekränkt hat, wie es ein strukturelles Phänomen im Kulturbereich widerspiegelt: "Migrant:innen" werden immer wieder auf ihre „vorgegebenen“ Rollen zurückgeworfen.
Fangen wir so an: Es war einmal ein Projekt. In dieses Projekt hatte ich sehr viel Arbeit, Zeit und Herzblut investiert, damit es zu dem wurde, was es schlussendlich geworden ist. Es war, wie man so schön sagt, „mein“ Projekt. Das Projekt wuchs und gedieh. Und schließlich war es an der Zeit für das Projekt, hinauszuziehen in die Welt. Es sollte sich in einer anderen Institution weiterentwickeln können. Daran, dass es mein Projekt war, hatte sich trotz allem nichts geändert.
Das sah eine:r der Kooperationspartner:innen des Folgeprojekts aber offensichtlich anders. In einer Besprechung über die Weiterführung des Projekts wurde mir klar, dass immer mehr Aufgaben in andere Hände gegeben werden sollten. Als ich thematisierte, was denn überhaupt meine künftige Rolle im Projekt sei, wurde mir gesagt, ich könne ja übersetzen. Statt wie bisher Inhalte zu gestalten sollte ich nun, da das Projekt strukturell fester verankert werden sollte, also dolmetschen. Ich fand das nicht nur aus rassismuskritischer Sicht bedenklich, sondern schlichtweg respektlos. Nicht genug: Als ich diese Rolle hinterfragte und eine Diskussion über die Rollen im Projekt startete, wurde ich wiederum gefragt, ob ich denn Geld dafür haben wolle. Das zeigte mir ebenso, dass der Kern des problematischen Verhaltens nicht verstanden wurde. Die Zusammenarbeit beim Projekt war als „Kooperation“ definiert und diese kann nur auf Augenhöhe passieren. Es ist traurig, dass dieser fast schon selbsterklärende Satz überhaupt formuliert werden muss. Auf eine kritische Rückmeldung zu dieser Vorgehensweise wurde nicht einmal reagiert.
Die geschilderte Erfahrung ist nur ein hervorstechendes Beispiel. Im Alltag passieren häufig mehr oder weniger subtile Respektlosigkeiten wie das Weglassen des Namens unseres Vereins JUKUS bei Kooperationen oder die Reduktion von JUKUS auf einen „migrantischen Verein“. Das macht die vielfältigen Tätigkeiten und Mitarbeiter:innen des Vereins unsichtbar bzw. reduziert sie auf Migration und bewirkt so ein Othering innerhalb der Szene.
Solche Erfahrungen passieren in unterschiedlichen Kontexten in unterschiedlichen Kulturszenen und -einrichtungen. Die Rolle der Migrant:innen soll jedoch (und es ist ermüdend, dass dies immer noch extra erwähnt werden muss) nicht nur die von Hilfstätigkeiten sein, sondern es soll auf Augenhöhe miteinander gearbeitet werden. Um nicht zu demotivieren, sondern zu motivieren und um „uns“ als Migrant:innen nicht als „Die Anderen“ sondern als einen gleichberechtigten und gleichwürdigen Teil eines Ganzen wahrzunehmen. Die Institutionen der Kunst und Kultur müssen auf die oben erwähnte unterschiedliche soziale Situiertheit von Migrant:innen reagieren, um eine aktive und emanzipative Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen.
Zurück zum eingangs kritisierten „zur Schau stellen“. Es darf bzw. soll nicht sein, dass Migrant:innen nur eine Bühne gegeben wird, um ihre (dramatischen) Geschichten zu präsentieren: wie sie diskriminiert werden, wie gemein die Mehrheitsgesellschaft zu ihnen ist, wie schrecklich ihre Migrations- oder Fluchtgeschichte ist etc. Um Migrant:innen nicht nur durch das Merkmal der Migration als Konsument:innen dabei zu haben, sollten bzw. müssen gesamtheitliche Prozesse mit Künstler:innen entwickelt und durchgeführt werden, die Migrationserfahrungen haben. Dies schafft auch gesellschaftliche Wiedererkennungsmöglichkeiten. Migrant:innen haben kein Interesse daran, ausschließlich ihre negativen Erfahrungen im Rahmen von Kunst und Kultur präsentiert zu sehen.
Ali Özbaş ist Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH JUKUS und hat in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen, öffentlichen Interventionen und Konferenzen mit Schwerpunkt Migration und Gesellschaftspolitik veranstaltet. Der Text stammt aus dem Jahr 2022.
[1] Im Projekt Re_stART_#Graz 2020 wurden Personen, die in ihren Herkunftsländern bereits künstlerisch-kreativ tätig waren, unterstützt, sich auch in Österreich wieder oder verstärkt ihrer Kunst zu widmen. Das Projekt beinhaltete unter anderem ein Mentoring, diverse Workshops und eine Ausstellung. Eine Beschreibung findet sich hier: https://www.kulturjahr2020.at/?s=re+start
[2] Die Kapitaltheorie nach Pierre Bourdieu besagt, dass der Erfolg, die soziale Position und die Macht eines Menschen in der Gesellschaft, durch den Besitz und die Anhäufung von 4 unterschiedlichen Kapitalformen bzw. Kapitalsorten bestimmt wird. Dabei geht es in der Kapitaltheorie aber um deutlich mehr als Geld, Vermögen und Gehalt. Bourdieu nennt hier das kulturelle Kapital, das soziale Kapital, das ökonomische Kapital und das symbolische Kapital. Mehr: Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (französ. 1979), Frankfurt am Main 1982.
