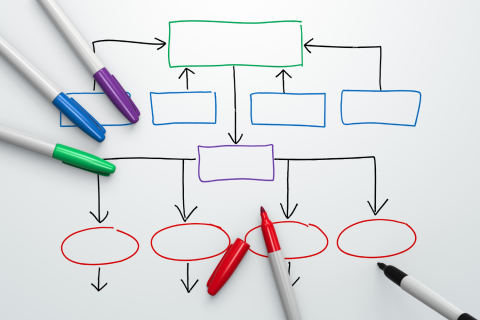Zwischen Aufbruch und Abbruch. Eine kurze Geschichte Hamburger Kunstprojekte im öffentlichen Raum
Gibt man das Stichwort "Kunst im öffentlichen Raum" in die Google-Suchmaschine ein, befindet sich Hamburg noch immer an erster Stelle der aufgerufenen Einträge. Weil Hamburg neben Bremen als einzige Stadt ein eigenes Budget nur für diese Kunstsparte eingerichtet hat, genießt es nach wie vor eine Vorreiterstellung im deutschsprachigen Raum.
Gibt man das Stichwort "Kunst im öffentlichen Raum" in die Google-Suchmaschine ein, befindet sich Hamburg noch immer an erster Stelle der aufgerufenen Einträge. Weil Hamburg neben Bremen als einzige Stadt ein eigenes Budget nur für diese Kunstsparte eingerichtet hat, genießt es nach wie vor eine Vorreiterstellung im deutschsprachigen Raum. [1] Dass KünstlerInnen sich unabhängig von der Kunst-am-Bau-Regelung Orte für ihre Projekte suchen können – entweder, indem sie Gelder hierfür bei der Kulturbehörde beantragen oder weil sie hierfür von der Stadt beauftragt werden – ist nach wie vor eine Ausnahme. International viel beachtete Projekte wie die "Offene Bibliothek" von Clegg & Guttmann oder das von Christoph Schäfer und Margit Czenki initiierte und auf der Documenta11 per Archiv dokumentierte Stadtteilprojekt "Park Fiction" konnten mit Hilfe dieser Regelung realisiert werden. Beide Projekte markierten die Hinwendung zu prozessorientierten Verfahren, bei denen weniger die Aufstellung von Objekten im städtischen Kontext, als die Initiierung von Projekten durch die Einbeziehung von Bevölkerungsgruppen im Vordergrund steht. Sie stehen aber auch für die symbolisch-modellhafte und dabei sehr konkrete Vorführung von Alternativen zur herrschenden Stadtteil- und Kulturpolitik durch KünstlerInnen.
So verstanden geben solche Projekte die Sicht auf die widersprüchliche Rolle der Auftraggebenden Kulturbehörde frei. Die Ermöglichung des Unmöglichen sei einer Strategie des "bewusst-gezielten Wegguckens" geschuldet, kommentiert Achim Könneke, in den 1990er Jahren Leiter des Bereichs "Kunst im öffentichen Raum", seine Arbeit: "Das Programm funktionierte dabei nach einem Selbstverständnis eines offiziell etablierten (Behörden-)Apparats, der von Künstlerinnen und Künstlern temporär instrumentalisiert werden kann". Park Fiction führt Konnicke als Beweis dafür an, dass kommunale Kulturpolitik im Ausnahmefall dazu dienen kann, den Widerstand gegen kommunale Politik zu unterstützen, denn: "Das Projekt Park Fiction von Christoph Schäfer im Rahmen von weitergehen mag als Beweis herhalten, dass es möglich ist, mit Kunstgeldern gegen ein Bauvorhaben anderer Senatsbehörden zu agieren, aufgrund günstiger politischer Konstellationen sogar politisch zu siegen und schließlich statt einer Wohnblockbebauung den von den Anwohnern selbst entworfenen people's park zu realisieren." [2]
Auch das letzte groß angelegte Projekt AUSSENDIENST (2000/01), eine Kooperation des Hamburger Kunstvereins und der Kulturbehörde unter kuratorischer Leitung von Stephan Schmidt-Wulffen und Achim Könneke, hatte noch als Ausgangsfrage, inwieweit KünstlerInnen "in gesellschaftliche Prozesse eingreifen und mit ihren Interventionen zu einem demokratischen Gemeinwesen beitragen" können. Erklärtermaßen hatten die Kuratoren allerdings die in den 1990er Jahren ausführlich und sehr kontrovers geführte Diskussion um die "New Genre Public Art" in ihre konzeptionellen Überlegungen einbezogen und sahen sich veranlasst, eine "Krise" der öffentlichen Kunst zu verzeichnen. Besonders in den USA hatte sozial engagierte Kunst immer häufiger Anlass zu kritschen Stellungnahmen gegeben. Einerseits war zu beobachten, dass offizielle Einrichtungen die Frage nach der "Gesellschaftsrelevanz" zu einem bestimmenden Förderkriterium erhoben hatten, was den Verdacht nahe legte, dass auf diese Weise in Dienst genommene Kunstprojekte dazu tendieren, die realen sozioökonomischen Verteilungsprobleme durch ihre "sanften" Strategien eher zu verschleiern als sie zu erhellen, jedenfalls aber zur Legitimation staatlicher oder industrieller Politiken beizutragen. Andererseits warnte man auf der Mikroebene der künstlerischen Konzeption vor einer Situation, in der "alles, was arm oder hilfsbedürftig, was echt und wirklich ist, zum potentiellen Objekt der Fürsorge und – Inspirationsquelle" wird.
So berechtigt und notwendig die Problematisierung interventionistischer Praxen war und ist, man kann sich beim Lesen der Stellungnahmen der AUSSENDIENST-Kuratoren nur schwer dem Eindruck entziehen, dass sie ihnen vor allem sehr gelegen kam. Allzu auffällig wird die "Legitimationskrise" der sich als "Speerspitze der Bewegung" verstehenden öffentlichen Kunst als Chance genutzt, sich freizuschwimmen und sich dem ungemütlich drängenden Zwang zur Parteinahme zu entziehen. Als Therapiemittel für die einseitig geführte Auseinandersetzung mit Theorien der radikalen Demokratie etwa schlägt Schmidt-Wulffen vor, sich auf Theorien der Subjektkonstruktion zu besinnen. Das geht dann so: Begreift man das Selbst als kontinuierlichen Formierungsprozess und jedes Werk als Kommunikationsmittel, dann ist potenziell jede künstlerische Arbeit an der "Bildung von Subjektivität und Öffentlichkeit beteiligt." Mithilfe dieses Subjektivitätsverständnisses und der Konzentration auf Prozesse der Gruppenbildung, "kommt eine Programmatik von Kunst im öffentlichen Raum eigentlich abhanden", so die erstaunliche Schlussfolgerung Schmidt-Wulffens. [3]
Um dem Verdacht zu entgehen, "Kunst zum Instrument der Politik zu machen" (oder andersherum?), wird der Ansatzpunkt künstlerischer Intervention nun wieder außerhalb von Konfliktpunkten hegemonialer Auseinandersetzungen angesiedelt, freilich nicht ohne zu betonen, "dass im Extremfall einer demonstrativen Zurschaustellung von Schönheit in der Stadt eine nicht weniger kritische Strategie zugrunde liegen kann." [4] Und als wäre damit keinerlei Programmatik verbunden und die Frage nach der Gesellschaftsrelevanz vom Tisch, entschied man sich in bewährt eklektizistisch-pluralistischer Manier, der ganzen Bandbreite an künstlerischer Skulptur Raum zu geben. Die Beobachtung, man habe es im innerstädtischen Bereich mit sehr heterogenen Soziotopen zu tun – KonsumentInnen, PensionärInnen, Drogenabhängige – war schließlich Ausschlag gebend für die konzeptionelle Vorgabe, die jeweils typischen "eingebürgerten" Verhaltensweisen der jeweiligen Gruppen aufzugreifen und zu stören. Der Vorteil eines solchen Ansatzes? "Bronceskulpturen mögen in solchen Prozessen eben so effektiv funktionieren wie Gesprächskreise" – und: "Die Beobachtung der großen Vielfalt unterschiedlicher Gruppen erweitert das Schema von Herrschern und Beherrschern so sehr, dass eine Parteinahme auch nur noch bedingt sinnvoll ist." [5]
Was durch den theoretische Kohärenz und Neutralität vortäuschenden Überbau hier verdeckt wird, ist, dass AUSSENDIENST von Beginn an an politische Bedingungen geknüpft war. Es ging darum, die "immer noch so wenig repräsentative Kunstmeile bespielend aufzuwerten". Obwohl nur nebenbei erwähnt, ist die Anbindung des Kunstprojekts an die Kunstmeile – also die Idee, alle großen Ausstellungshäuser im Innenstadtbereich durch eine Art Parcours zu verbinden – nicht ganz ohne Bedeutung. Denn die übertriebene Standortkonzentration von Skulpturen im Umfeld von Museen und Bahnhofsbereich (bei gleichzeitiger Aussparung aller unmittelbar angrenzenden Wohngebiete) steht in klarem Zusammenhang mit Hamburgs Wettbewerb um Standortvorteile und Tourismusattraktionen und gibt der Rede von "Identitätskonstruktion" und "Gruppenbildung" den Beigeschmack von zielgruppenorientiertem Kundenfang.
Darüber hinaus lässt sich AUSSENDIENST als eine Art Vorbereitung für noch ausstehende kulturpolitische Aufgaben in der Hamburger Innenstadt verstehen. Denn bei der Umstrukturierung und Entwicklung der Hafencity, der Neuerschließung eines ganzen Stadtteils (155 Hektar) in und als Erweiterung der Speicherstadt setzt der Senat natürlich auf die rege Mitwirkung durch die Kunst. Ein im Rahmen des Kunstprojekts veranstaltetes Symposion zum Thema "Wo steht die Kunst?" widmete sich denn auch den Fragen der Stadtentwicklung, Urbanitätsverständnissen und den hieraus resultierenden Herausforderungen für Kulturpolitik und Kunst.
Seither ist es erstaunlich still geworden um die öffentliche Kunst in der Hansestadt. Links auf neue Projekte befinden sich 'under construction', an der Neuformulierung der Programmatik werde gearbeitet, erfährt man. Was ist seither geschehen?
Zunächst litt der Bereich "Kunst im öffentlichen Raum" unter personalpolitschen Schwierigkeiten. Nach den Kommunalwahlen 2001 und dem Einzug von CDU/FDP/Schill ins Rathaus brauchte es zunächst drei Monate, um unter Einsatz eines Headhunters die Stelle der Kultursenatorin neu zu besetzen. Dass man Kandidatinnen wie die Schlagersängerin Vicki Leandros und Richard Wagners Urenkelin Nike Wagner in Erwägung zog, wies bereits in die zu erwartende kulturpolitische Zukunft. Die Entscheidung für die ehemalige "Welt am Sonntag"-Journalistin und Bild-Ressortleiterin Dana Horakóvá endlich ließ keinen Zweifel mehr über das Kulturverständnis der Ole von Beust-Regierung. "Glanz" und eine neue "Image-Line" hießen die neuen kulturpolitischen Kernbegriffe, und Projekte wie das "Aquadom" veranlassten die Senatorin, ihren Phantasien ungebremst Ausdruck zu verleihen: "Magische Kraft der Musik am Abend und tagsüber von der Faszination der Unterwasserwelt und der Begegnung mit den Beatles in einem Popmuseum". Auch im Bereich öffentliche Kunst versuchte Horakóvá ihren Einfluss geltend zu machen, indem sie den von der Behörde für Bau und Verkehr in Auftrag gegebenen Vorschlag für eine gigantomanische Skulptur auf dem Spielbudenplatz von Jeff Koons öffentlich lobpreiste. Da das Raum greifende bunte "Tor zur Welt" aus Kränen, Ankern, Schnurrbärten und gespreizten Frauenbeinen sich schließlich doch als unfinanzierbar erwies, wurde die Platzgestaltung jüngst erneut ausgeschrieben.
Apropos Geld: Während die Stadt dem Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Verlags, Peter Tamm, 30 Millionen Euro Unterstützung für die Einrichtung seines Marinemuseums in der Hafencity fest zugesichert hat, war die Streichung sämtlicher Mittel für kommunale Geschichtswerkstätten sowie die Halbierung des Etats für "Kunst im öffentlichen Raum" schnell beschlossene Sache. Auf allzu großen Widerstand dürfte man bei letzterer Kürzung insofern nicht gestoßen sein, als die Stelle des Leiters der Behörde für Kunst im öffentlichen Raum nach Achim Könnekes Weggang vakant blieb. Und dieses mit nur kurzer Unterbrechung für die Dauer von zwei Jahren.
Seit Dezember 2003 wird nun unter der neuen Leiterin Munise Demirel in verschiedenen Arbeitsgruppen an neuen Rahmenrichtlinien für die Kunst im öffentlichen Raum gearbeitet. Neben Pflichten wie der Instandhaltung und Pflege bereits existierender Arbeiten, die bei einem Jahresbudget von nunmehr 250.000 Euro ein Fünftel des Haushalts verschlucken, hat man sich vorgenommen, die Hamburger stärker auf den Bestand aufmerksam zu machen und die Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit auszubauen. Eine stärkere Kooperation mit den Bezirken werde gesucht.
Was die Entwicklung neuer Arbeiten anbelangt, verfolgt die Behörde eine zweigleisige Strategie. Obwohl sich prinzipiell an der freien Ortswahl nicht geändert habe, liege der Schwerpunkt dennoch auf dem Gebiet der Hafencity. Angestrebt sei die Einbeziehung von KünstlerInnen bei den Planungsprozessen der Stadtentwicklungsbehörde unter dem Stern von Public-Private-Partnerships. Für die nun voraussichtlich für mehrere Jahre anhaltende Erschließung des Hafengebiets bildete ein erstes mehrteiliges Projekt zum Thema "Zoll / Douane" den Auftakt und Anreiz zum symbolträchtigen Grenzübergang. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie sukzessive auch Lagerhallen, Speicher und Anlegestellen ebenso temporär illuminiert, mit Projektionen versehen und zum Kunstraum erklärt werden, um die nötige Umwertung des Industriegebiets vorzunehmen.
Nun hat die aggressive Stadtentwicklungspolitik unter dem Titel "Wachsende Stadt" und dem Credo "Die Metropole Hamburg muss zur unverwechselbaren Marke werden" auch ihre Schattenseiten. Gentrifizierungsprozesse in beliebten Innenstadtvierteln führen zu Umsiedlungen, ehemalige Einkaufstraßen weisen zunehmend Leerstand auf – wir kennen das Szenario. Auch für die so entstehenden Problemzonen, inoffiziell als 'Un-Orte' bezeichnet, will man verstärkt KünstlerInnen gewinnen, um beispielsweise leer stehende Ladenräume zu bespielen und die Ödnis außerhalb des Zentrums wieder mit Leben zu füllen.
So scheinen die Stadtentwickler fürs Erste das Anforderungsprofil für die öffentliche Kunst fest in der Hand zu haben. Potenziell endlos obliegt es Kunst, an ihren Baustellen Sinn stiftend zu wirken: hier den Aufbruch mit der nötigen Imagination zu versehen und dort den Abbruch durch Trauerarbeit erträglicher zu machen. Bleibt zu hoffen, dass jemand mal wieder "bewusst-gezielt wegguckt".
Anmerkungen
[1] Zur programmatischen Entwicklung des Bereichs "Kunst im öffentlichen Raum" in Hamburg meinen Beitrag: "Fortschrittliche Stolpersteine. Was wurde aus den Hamburger Programmen zur 'Kunst im Öffentlichen Raum'?", in: Kulturrisse 04/01
[2] Achim Könneke: AUSSENDIENST, in: Achim Könneke/Stephan Schmidt-Wulffen (Hg.): AUSSENDIENST. Kunstprojekt in öffentlichen Räumen Hamburgs, Freiburg 2002, S. 85
[3] Vgl. Stephan Schmidt-Wulffen: Kunst im öffentlichen Raum – eine Revision, in: Achim Könneke/Stephan Schmidt-Wulffen (Hg.): AUSSENDIENST. Kunstprojekt in öffentlichen Räumen Hamburgs, Freiburg 2002, S. 97–103
[4] Achim Könneke: AUSSENDIENST, in: Achim Könneke/Stephan Schmidt-Wulffen (Hg.): AUSSENDIENST. Kunstprojekt in öffentlichen Räumen Hamburgs, Freiburg 2002, S. 87
[5] Stephan Schmidt-Wulffen: Kunst im öffentlichen Raum – eine Revision, in: Achim Könneke/Stephan Schmidt-Wulffen (Hg.): AUSSENDIENST. Kunstprojekt in öffentlichen Räumen Hamburgs, Freiburg 2002, S. 103
Rahel Puffert ist Kulturwissenschafterin, forscht zumThema Kunstvermittlung und lebt in Hamburg.