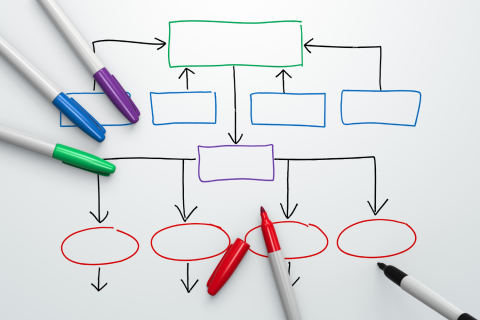VorRisse
„Wie parieren wir den partizipatorischen Kuschelangriff? Gibt es Wege aus der Vereinnahmungsfalle?“, fragte vor etwas mehr als einem Jahr der Kongress Recht auf Stadt in Hamburg und brachte damit eine in letzter Zeit auch hierzulande immer wieder aufflammende Debatte pointiert auf den Punkt: Wie lassen sich in der „kreativen Stadt“ der Gegenwart künstlerische und kulturarbeiterische Praxen entwickeln, ohne dabei durch Stadtmarketing bzw. Parteipolitik für Gentrifizierungs- oder vergleichbare Zwecke vereinnahmt zu werden?
„Wie parieren wir den partizipatorischen Kuschelangriff? Gibt es Wege aus der Vereinnahmungsfalle?“, fragte vor etwas mehr als einem Jahr der Kongress Recht auf Stadt in Hamburg und brachte damit eine in letzter Zeit auch hierzulande immer wieder aufflammende Debatte pointiert auf den Punkt: Wie lassen sich in der „kreativen Stadt“ der Gegenwart künstlerische und kulturarbeiterische Praxen entwickeln, ohne dabei durch Stadtmarketing bzw. Parteipolitik für Gentrifizierungs- oder vergleichbare Zwecke vereinnahmt zu werden? Welche Strategien und Allianzen sind nötig, um im Rahmen solcher Praxen – jenseits von einmaligen Events und rein symbolischen Eingriffen – nachhaltige Strukturen der Selbstermächtigung aufzubauen? Diesen und ähnlichen Fragen ist der Heftschwerpunkt der vorliegenden Kulturrisse-Ausgabe gewidmet.
Klaus Ronneberger analysiert in seinem einleitenden Beitrag dabei das Leitbild der „kreativen Stadt“ vor dem Hintergrund des mit dem flexiblen Kapitalismus der Gegenwart verbundenen Modells der unternehmerisch orientierten Erlebnisstadt. Darüber skizziert er grob das von Ambivalenzen und Widersprüchen geprägte Feld, in dem KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen aktuell in urbanen Kontexten agieren. Auf der Basis einer empirischen Studie zum Thema wird dies in der Folge von Philipp Rode anhand des Verhältnisses von Wiener Kunst- und Kulturprojekten zu Prozessen der Stadterneuerung konkretisiert. Angesichts ihrer divergierenden Positionierung im städtischen Rahmen arbeitet er verschiedene Strategien heraus, die seitens besagter Projekte im Spannungsfeld zwischen Eigeninitiative und Vereinnahmung entwickelt werden. Mit einem zentralen Aspekt der Debatte, nämlich der Zwischennutzung von Leerstand, beschäftigen sich alsdann Anna Hirschmann und Raphael Kiczka in ihrem Artikel. Dabei zeigen sie anhand konkreter Beispiele aus Wien auf, wie Kunst- und Kulturprojekte in einem solchen Rahmen die Einbindung in eine neoliberale Umstrukturierung der Stadt vermeiden und stattdessen Widerständigkeit fördern können.
Im Anschluss daran fragen content.associates, ein interdisziplinäres Team von u. a. KünstlerInnen und ArchitektInnen, nach Möglichkeiten dafür, Kulturarbeit in alternativer Form in Stadtentwicklungsprojekte einzubinden und der Bevölkerung öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Den Hintergrund dieser Fragestellung bildet das von ihnen kürzlich in der Seestadt aspern, einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, realisierte Projekt Publik. Gleichfalls von einem konkreten Fallbeispiel, nämlich von einem selbstverwalteten Zentrum für Kunst in Mailand namens Macao, geht der abschließende Beitrag zum Heftschwerpunkt aus. Emanuele Braga skizziert darin, wie dieser Versuch der Besetzung und Schaffung kultureller Räume im historischen und lokalen Kontext zu verorten ist und worauf er im Zusammenhang mit dem Kampf um das Allgemeingut abzielt.
Wie die Beiträge zum Heftschwerpunkt bestätigen, sind also auch kritisch intendierte Kunst- und Kulturprojekte nicht davor gefeit, in stadtentwicklerische Prozesse wie jenen der Aufwertung und Verdrängung verstrickt bzw. bewusst dafür in Dienst genommen zu werden. Zugleich verdeutlichen sie, dass der hierin zum Ausdruck kommende Widerspruch auf individueller Ebene nicht aufzulösen ist. Als doppelte Voraussetzung für seine kollektive Bearbeitung benannte der Stadtsoziologe Andrej Holm in Heft 2/2011 der Kulturrisse die „Bereitschaft zu Bündnissen und Kooperationen jenseits des eigenen Milieus“ sowie die „Auseinandersetzung mit den eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen“. Im Hinblick auf beide Vorhaben wartet die vorliegende Ausgabe mit Handlungsansätzen und -strategien auf.