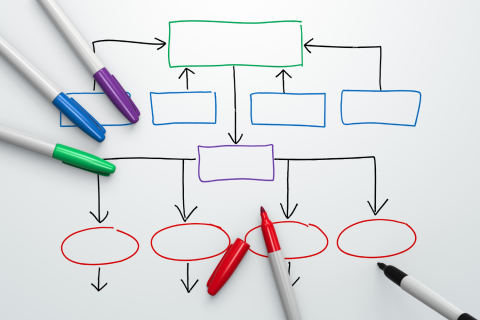Nach dem Wunderland - Für eine neue Politik der Kulturalität
Kulturpolitik, die – mit erstaunlichen Parallelen zum literarischen Wunderland – seit geraumer Zeit auf ähnlich phantastische Weise vor allem die Unzuverlässigkeit von politischer Gestaltung und Kommunikation zum Vorschein bringt, weiß in Österreich aus ihrer selbst verschuldeten Daseinskrise keinen Ausweg mehr.

Martin Wassermair
Nach dem Wunderland.
Für eine neue Politik der Kulturalität
Im November 2016 trat die österreichische Wirtschaftskammer im Rahmen einer aufwändig inszenierten Veranstaltung in Erscheinung, um wieder einmal unter großem Pomp und Trara den – wie WKO-Präsident Christoph Leitl gerne schwadroniert – „abgesandelten“ Zustand des Landes zu beklagen. Das ist soweit noch keine Neuigkeit. Für Verwunderung sorgte vielmehr ein eigens für diesen Anlass ausgewählter Slogan, der verblüffend an die republikanische Kampagne im Zuge der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen im gleichen Zeitraum erinnerte, nach dem Wahlergebnis jedoch in Anbetracht eines Donald Trump an der Spitze der Supermacht weltweit unweigerlich Besorgnis und Ratlosigkeit nach sich ziehen sollte. „Make Austria great again!“ So war nun die rot-weiß-rote Ausführung auf dem überdimensionierten Hintergrund der Bühne zu lesen – als eine mehr als unbeholfene Analogie an das politische Statement, das sich in den Vereinigten Staaten kurz zuvor in beispiellos hetzerischer und hasserfüllter Feindschaft gegenüber Frauen, Fremden und Andersdenkende tief durch die Gesellschaft gegraben hatte.
„Make Austria great again!“ Ganz plötzlich türmen sich auch hierzulande kognitive Dissonanzen auf, die eine wachsame Aufmerksamkeit finden müssen. Aber wie ist dem Wahn von Größe und Überlegenheit am ehesten zu begegnen? Darf Österreich gar einer kulturellen Revolution entgegensehen? Die Medizin kennt den Begriff des Alice-im-Wunderland-Syndroms. Dieses bezeichnet beim pathologischen Befund weniger ein Krankheitsbild, sondern eine Symptomatik, die bei Menschen im Falle starker Migräne als Begleiterscheinung zutage treten kann. Dabei entstehen massive Veränderungen der Wahrnehmung, die nun die Umgebung entweder verkleinert, oder aber – was noch häufiger vorkommt – die tatsächliche Größe deutlich überzeichnet. Doch was hat das alles mit Kultur und Politik zu tun?
Bis heute weiß das von Lewis Carroll verfasste Buch „Alice im Wunderland“ zu begeistern. Der britische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zieht nicht nur Kinder seit Generationen in seinen Bann, sondern auch unterschiedliche Disziplinen der Wissenschaften. Und tatsächlich zeichnet sich das Werk vor allem dadurch aus, dass sich auf phantastische Weise die Unzuverlässigkeit von Logik und Rationalität in der Unzuverlässigkeit von Sprache und Kommunikation widerspiegelt. Denn ungeachtet der couragierten Konfrontation mit dem Wunderland bleiben in der Welt der kleinen Alice die Begegnungen stets zum Scheitern verurteilt, weil sie als Hauptfigur nie die richtigen Worte zu finden scheint.
Kulturpolitik, die – mit erstaunlichen Parallelen zum literarischen Wunderland – seit geraumer Zeit auf ähnlich phantastische Weise vor allem die Unzuverlässigkeit von politischer Gestaltung und Kommunikation zum Vorschein bringt, weiß in Österreich aus ihrer selbst verschuldeten Daseinskrise keinen Ausweg mehr. Gefangen im Gewirr aus New Public Management, Gleichgültigkeit, Budgetkürzungen, Bestandsverwaltung, Traditionspflege und Realitätsverweigerung, hat sie sich in den Kontexten von Kunst, Kultur und Medien mittlerweile weitgehend selbst enthauptet. Zuvor schöpfte Kulturpolitik – jedenfalls in einer noch selbstbewusst sozialdemokratischen Lesart – ihre Behauptung aus dem Anspruch gesellschaftspolitischer Wirkungsmacht. Mit dem Entstehen zahlreicher Kulturinitiativen und selbstorganisierter Zentren keimte zudem in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren das entschlossene Paradigma auf, sich auch in Österreich der schier unüberwindbar anmutenden Antimoderne mit alternativen Ansätzen zu widersetzen und ein Kulturverständnis zu etablieren, das den Zeichen der Gegenwart Rechnung tragen sollte. Antiautoritäre Erziehung, Friedensarbeit, internationale Solidarität und Geschlechtergerechtigkeit wurden plötzlich als Leitmotive einer gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung hochgehalten, um der repressiven Nachkriegsordnung fortan eine unmissverständliche Absage zu erteilen. Sie galt nicht zuletzt auch als ultimative Kampfansage an den „repräsentativen Kulturalismus“, mit dem etwa Kultusminister Heinrich Drimmel (ÖVP) die illiberale Geisteshaltung der 1950er Jahre für immer und ewig einzuzementieren suchte.
Jahrzehnte später trat also plötzlich ein Verständnis von autonomer Kunst- und Kulturarbeit auf den Plan, das auch den Konflikt um die hegemoniale Deutungshoheit über den Kulturbegriff an sich nicht scheute. Fernab aller gesellschaftlichen Konventionen, in Abgrenzung zu Konsum- und Verwertungszwängen, richtete sich das aufbegehrende Augenmerk auf die Errichtung und Erschließung neuer gesellschaftlicher Räume. Die damit verbundenen kleineren und größeren Erfolge sollten allerdings nicht lange währen. Die kulturelle Praxis, die noch zuvor mit leidenschaftlichem Einsatz für soziokulturelle Teilhabe und Ermächtigung in einem solidarischen Gemeinwesen gestritten hat, sieht sich in der frühen Phase des 21. Jahrhunderts schon wieder deutlich in der Defensive.
Vorbei sind also die Zeiten, als sich noch eine große mediale Öffentlichkeit der erhitzten Auseinandersetzung widmete, was denn in der Kunst erlaubt sei und was nicht. Heutzutage ist es gar nicht mehr so einfach, für Provokation und Aufregung zu sorgen. So sind auch die Verantwortlichen in den Kulturressorts allmählich in die hinteren Ränge zurückgetreten und überlassen das Feld der Administration, die – wenn nicht mal wieder in den angesehenen Häusern und Institutionen schwerwiegende Vorwürfe einer grob mangelhaften Finanzgebarung zutage treten – in ihrer Bestandsverwaltung weitgehend unauffällig bleibt. Vor dem Hintergrund dieser selbstreferentiellen Schattenwelt haben unterdessen rechtspopulistische Parteien und extreme Rechte das Ruder an sich gerissen – und geben damit den Takt auch in der viel grundsätzlicheren Frage von Sinngebung und Bestimmung bei der Kulturaneignung vor.
Der rechtskonservative Kampfbegriff der Leitkultur hat dem ehemals emanzipatorischen Verständnis von Kultur das Substrat von Vielfalt, Experiment und Kontroverse rücksichtslos entzogen. Jetzt gedeihen auf diesem Boden Ausgrenzung, Segregation und ein rassistischer Vernichtungswille. Und tatsächlich ist große Vorsicht geboten – denn wer heute von Kultur spricht, meint inzwischen mehrheitlich Identität, erweckt das Gefühl von völkischer Gemeinschaft und verspricht das Wohlergehen durch Grenzziehung, Abwehr alles Fremden – und in letzter Konsequenz durch Krieg.
„Make Austria great again“ führt noch keineswegs in den Völkermord – mitnichten! Der Ruf der Wirtschaftstreibenden ist aber dennoch beispielhafter Ausdruck einer Ideenwelt, die sich vor dem Universalen zunehmend verschließt, das Kleinkrämerische als ökonomische Zukunftsbranche vermarktet und genau dadurch aber die identitäre Falle immer weiter öffnet. Kunst- und Kulturschaffende kommen nicht umhin, sich die globalisierten Schlachtfelder zu vergegenwärtigen. Bislang dürfen künstlerische und kulturelle Hervorbringungen in Österreich den Stellenwert einer ministeriellen Schatzkammer genießen, die es mit enormen finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Hand zu hegen und zu pflegen gilt. Damit wird jedoch den dramatischen Verwerfungen und Umbrüchen unserer Zeit nicht einmal annähernd entsprochen.
Die Repolitisierung von Kulturpolitik zur Aufhebung ihrer selbstverschuldeten neoliberalen Nichtigkeit muss den Weg von Reflexion, Theoriebildung und Disput einschlagen. Somit hat nicht das kulturelle Erbe, sondern die kritische Auseinandersetzung mit den vordringlichsten Fragen von Gegenwart und Zukunft die höchste Priorität. Das Verhältnis von Kulturverwaltung zu ihrer politischen Zielformulierung wirkt nach den Jahren der sozialpartnerschaftlichen Beschaulichkeit geradezu wie zerrüttet. Angesichts der sich radikal abzeichnenden Kulturalisierung von Desintegration und Überwachung sowie des Abbaus einer pluralistischen Demokratie ist es allerdings höchste Zeit, Grundzüge für eine neue Politik der Kulturalität zu entwerfen, die nicht vor den vielen ökonomischen und gesellschaftlichen Widersprüchen unserer Zeit erstarrt. Kunst- und Kulturschaffende sind schon jetzt mehr als zuvor gefordert, sich nicht den Profitparadigmen zu unterwerfen, sondern den Anspruch auf Veränderung ganz eng mit den unumstößlichen Grundsätzen von Menschenrechten, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen – als Schablonen des Zusammenwirkens von Kultur und Politik, die als verbindliche Maßgabe zur Überwindung der vielen Zerwürfnisse und Kriege, der wachsenden Armut und schwindenden Solidarität anzuwenden sind.
Martin Wassermair ist Historiker und Politikwissenschaftler und aktuell Leiter der Politikredaktion von Dorf TV.