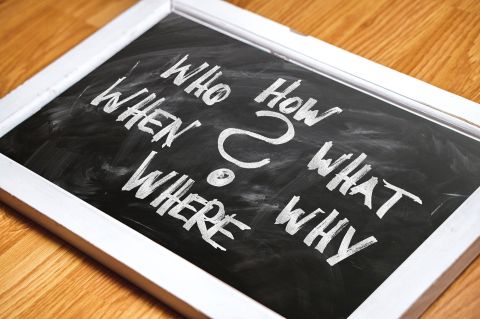Lasst es brennen!
Mit der Besetzung europäischer Universitäten konnte sich in den letzten Monaten eine neue Bewegung formieren, der es sowohl um die Eröffnung autonomer Räume innerhalb universitärer Einrichtungen als auch um die Etablierung eigener Formen der Wissensproduktion und -distribution außerhalb bestehender Institutionen geht.
Mit der Besetzung europäischer Universitäten konnte sich in den letzten Monaten eine neue Bewegung formieren, der es sowohl um die Eröffnung autonomer Räume innerhalb universitärer Einrichtungen als auch um die Etablierung eigener Formen der Wissensproduktion und -distribution außerhalb bestehender Institutionen geht. Die Öffnung der Universität ist dabei nicht als hohle Phrase aus vergangenen Zeiten zu verstehen, sondern versucht selbst den Kampf um die Universität in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu verorten. Damit zeigt sich gerade auch in den Bildungsprotesten an Österreichs Universitäten ein qualitativer Unterschied zu vergleichbaren Bewegungen in den Jahren zuvor. So wurde 1987, 1996 und 2000 zwar ebenfalls das Audimax als symbolischer Ort besetzt, jedoch gingen die einzelnen Aktionen zumeist nicht über diesen Symbolcharakter hinaus. Die Widerstandsformen im Zuge der jüngsten Besetzungen bergen dagegen das Potenzial, über den lokalen Bezug der jeweiligen Universität hinaus in andere gesellschaftliche Bereiche zu intervenieren und somit eine transversale Ausrichtung zu ermöglichen.
Der singuläre und für österreichische Verhältnisse freilich herausragende Moment der jüngsten Ereignisse sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der derzeitige Protest bereits auf eine Reihe zuvor gegründeter Initiativen zurückgreifen konnte. Als Ergebnis jahrelanger Arbeit ist dieser auch Teil einer internationalen Bewegung, die sich unter anderem im Herbst 2008 in Frankreich, im Frühjahr 2009 in Kroatien oder im vergangenen Juni in Deutschland gegen die neoliberale Umstrukturierung der europäischen Hochschullandschaft durch den Bologna-Prozess aufgelehnt hat. Denn die Ausrichtung der Lehrinhalte am Arbeitsmarkt, gepaart mit der Notwendigkeit, die Universitäten als standortgerechte Dienstleistungseinrichtungen zu positionieren, verweisen auf einen allgemeinen Transfor-mationsprozess, welcher – als Bestandteil der europäischen Lissabon-Strategie zur Schaffung eines einheitlichen und kompetitiven Wirtschaftsraums – Bildung und Wissen zunehmend in eine vermarktbare Ware verwandelt. Unabhängige Forschung sowie die Möglichkeit, selbstbestimmt und kritisch zu lernen, werden dadurch weiter eingeschränkt.
Durch die zunehmende Kommodifizierung von Wissen bei gleichzeitiger Normierung und Standardisierung der Studien scheint die Universität nunmehr selbst an ihr Ende gekommen. Die Rückkehr zum alten Projekt einer bürgerlichen Bildungselite ist daher ebenso unwahrscheinlich wie die Verteidigung einer vermeintlich offenen Massenuniversität. Bildung ist zu einer Ware geworden, die in Form arbeitsmarktgerechter Ausbildung zur globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas beitragen soll. Die Entzauberung bildungspolitischer Ideale enthält dabei allerdings auch die Chance, dass sich die studentischen Proteste nicht mehr mit universitärer Nabelschau aufhalten, sondern gleich eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einnehmen. Diese ist nur zu erreichen, wenn die zynische Distanzierung im Namen einer allgemeinen Fantasielosigkeit durch ein konkretes Handeln in konkreten Situationen abgelöst wird. Eine Bewegung zur Überwindung herrschender Geschlechterverhältnisse, rassistischer Zuschreibungen und des Kapitalverhältnisses in und außerhalb der Universitäten könnte so einen Funken entfachen, der auch auf andere gesellschaftliche Bereiche überzuspringen vermag. In diesem Sinne: Lasst es brennen!